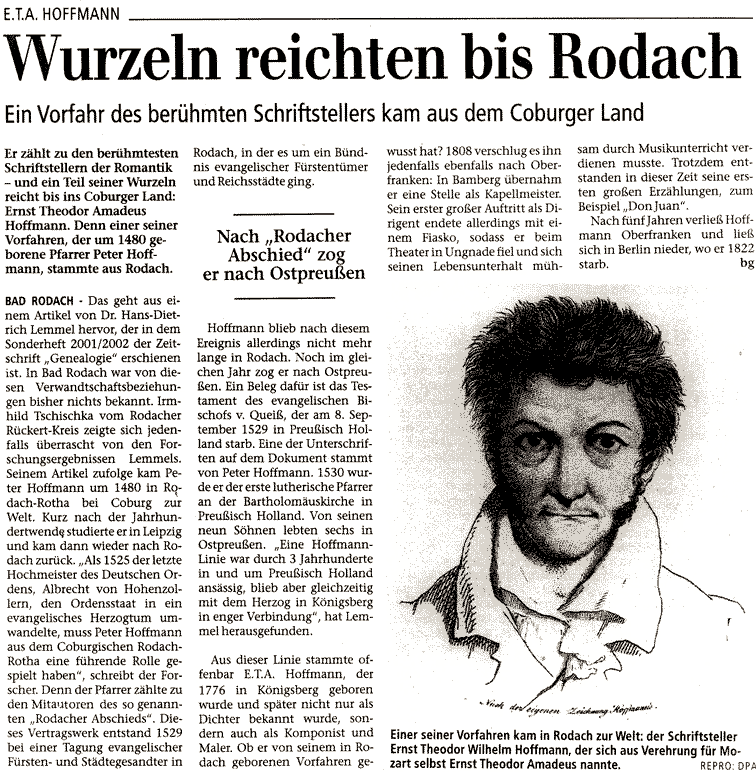zurück zum Haupt-Index
V
Zur Stammtafel der Familie Hoffmann in Ostpreußen
Zum 225. Geburtstag:
E.T.A. Hoffmanns Vorfahren
von Hans-Dietrich Lemmel
Ursprünglich gedruckt
1.) in "Genealogie" Band 25 S.545-556 2001,
2.) in "Genealogie" Sonderheft 2001/2002 S.1-12,
3.) im Heimatbrief der Kreisgemeinschaft Pr.Holland Nr.19 2002/2003 2.30-40.
Seither geringfügig ergänzt.
Presse-Echo in der Neuen Presse Coburg 2002 (siehe unten)
Kurze Besprechung dazu in der Zeitschriftenrundschau 2001 der
Schweizerischen Gesellschaft für Familienforschung SGFF
(Internet).
In der Literatur fand man früher, dass E.T.A. Hoffmann aus der masurischen
Familie Hoffmann-Baginski stammen soll. Das ist ein Irrtum.
Wahrscheinlich gehört er zu der ostpreußischen
Pfarrer-Familie Hoffmann, die von Peter Hoffmann abstammt, der 1530 als
evangelischer Pfarrer aus dem Coburgischen nach Preußisch Holland
kam.
1. Einleitung
.
Der vielseitig begabte Jurist, romantische Dichter,
Komponist und
Maler Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, der sich in Verehrung zu Wolfgang
Amadeus Mozart selbst Ernst Theodor Amadeus nannte, wurde am 24.1.1776
in Königsberg geboren. Nach einem wechselvollen Lebenslauf in
Königsberg, Glogau, Berlin, Posen, Plock, Warschau, Bamberg,
Leipzig und Dresden, starb er am 25.6.1822 in Berlin.
Nach dem Untergang Königsbergs feiert man E.T.A.Hoffmann vor
allem
in Bamberg, wo er 1808-1813 fünf fruchtbare und krisenreiche
Jahre
zubrachte, die Peter Härtling in einem neuen Buch (1)
schildert.
Zu seinem 225. Geburtstag hörte man vermehrt Hoffmann-Musik in
Konzertsälen und im Radio; seiner Statue am Bamberger
Schillerplatz
legte ein Verehrer einen Lilienstrauss in den Arm; gegenüber
blieb
das Museum in Hoffmanns nur zwei Fensterachsen schmalem Wohnhaus
freilich geschlossen.
 Das
E.T.A.Hoffmann-Denkmal in Bamberg
Das
E.T.A.Hoffmann-Denkmal in Bamberg
[Foto H.D. Lemmel]

E.T.A.Hoffmann ist ein waschechter Ostpreuße:
Seine Eltern
und Großeltern liegen auf Friedhöfen an den Ufern
des
Pregel, vier von ihnen in Königsberg, zwei in Tapiau und
Insterburg. Die Vorfahren, die bis zur Generation der
Ururgroßeltern bekannt sind, waren vorwiegend Pfarrer und
Juristen in Ostpreußen.
Die bekannteste Ahnfrau ist die Pfarrerstochter Anna Neander aus Tharau
am Frisching-Fluss 15 km südlich von Königsberg: Zu
ihrer
Heirat am 11.9.1636 im Königsberger Dom mit dem Pfarrer
Johannes
Partacius schrieb Simon Dach ein Lied, das ihren Namen weithin bekannt
machte: "Annke van Tharau".
 Simon Dach [aus
Schumacher: Geschichte Ostpreußens, Rautenberg 1957]
Simon Dach [aus
Schumacher: Geschichte Ostpreußens, Rautenberg 1957]
Die Hoffmannsche Ahnentafel, die aus Vorkriegsforschungen bekannt ist,
wurde 1943 von Eduard Grigoleit veröffentlicht (2).
Ausführliche Angaben, nicht nur zu den Ahnen sondern auch zu
den
Ahnengeschwistern, findet man in Band 3 von "E.T.A.Hoffmanns
Briefwechsel", herausgegeben 1969 von Hans v.Müller und
Friedrich
Schnapp (3). Aus diesen beiden Quellen wird hier die folgende
Ahnenliste wiedergegeben.
Darin gibt es zweimal eine Heirat von Vetter und Kusine, woraus ein
beträchtlicher Ahnenschwund folgt: in der Ahnenreihe 64-127
gibt
es de facto nur 40 statt 64 Ahnen.
Für einige der Vorfahren ist es bekannt, von wo sie nach
Ostpreußen zuwanderten: Es sind dies evangelische Pfarrer aus
Niederschlesien und aus der Mark Brandenburg, sowie ein Schuhmacher
aus Dinkelsbühl: dessen Sohn pachtete südlich von
Königsberg ein Bauerngut, heiratete eine Pfarrerstochter, und
wurde schließlich Gutsbesitzer in Hanswalde, wo er auch eine
Amtsfunktion ausübte, die ihm den Titel eines "Burggrafen"
einbrachte.
2. Die Ahnenliste von E.T.A. Hoffmann
1. Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann
- Jurist, Dichter, Komponist und Maler, * 24.1.1776 in
Königsberg/Pr., † 25.6.1822 in Berlin. Er
änderte
seinen Vornamen in Ernst Theodor Amadeus.
2.Generation (Eltern):
2. Christoph Ludwig Hoffmann
- Jurist in Insterburg, * um 1736 (Lücke im Taufbuch) in
Neumark
bei Preußisch Holland, † 27.4.1797 in Insterburg.
1752/1753
Univ.Königsberg, 1776 Hofgerichtsadvokat in
Königsberg,
später Kriminalrat und Justizkommissar in Insterburg; oo
29.10.1767 in Königsberg Altstadt
3. Lowisa Albertina Doerfer, getauft
23.7.1748 in
Königsberg, † 13.3.1796 in Königsberg.
1778 geschieden.
3.Generation
(Großeltern):
4. Friedrich Christoph Hoffmann
- Pfarrer in Neumark, * 18.8.1708 in Neumark, † 16.6.1758 in
Tapiau.
1721 Gymnasium Elbing, 1724 Univ.Königsberg, 1733 in der
Königsberger Schloßkirche ordiniert, Pfarrer in
Neumark und
Carwinden, 1751 Diakon und 1755 Pfarrer in Tapiau; oo um
1733
5. Maria Elisabeth Voeteri, * um 1713
in Glommen
(südlich von Königsberg), † 21.3.1789 in
Königsberg.
6. Johann Jakob Doerffer
- Jurist in Königsberg, * 4.6.1711 in Didlacken Kreis
Insterburg,
† 21.6.1774 in Königsberg Tragheim. 1729
Univ.Königsberg,
1736 Hofgerichtsadvokat in Königsberg, daneben 1747 Rat am
Samländischen Konsistorium, 1755 Beisitzer am "Collegium
Montis
Pietatis"; oo 17.6.1739 in Klein Waldeck (südöstlich
von
Königsberg)
7. Lovisa Sophia Voeteri, getauft
1.5.1712 in
Glommen, † 21.4.1801 in Königsberg Tragheim.
4.Generation
(Urgroßeltern):
8. Petrus Hoffmann
- Pfarrer in Neumark, * 15.8.1676 in Lomp bei Preußisch
Holland,
† 23.2.1726 in Neumark. 1694 Univ.Königsberg,
1707-1726 Pfarrer in
Neumark und Carwinden; oo 18.1.1707 in Ragnit
9. Anna Magdalena Koch, * um 1685 in
Stöberitz/Mark, begraben 3.1.1748 in Neumark. 1707
Kammerjungfer
in Ragnit bei der Gräfin
zu Dohna.
10. Tobias Christoph Voeteri/Vetter
- Gutsherr, * 19.9.1677 in Dinkelsbühl, † 1.10.1761
in Hanswalde.
1711 in Bartenstein, dann Pächter von verschiedenen
Gütern
südlich von Königsberg, schließlich
Besitzer des
adligen Gutes Hanswalde (zwischen Tapiau und Friedland östlich
von
Königsberg), Burggraf (=Amtsverwalter); oo 20.1.1707 in Tharau
südlich von Königsberg
11. Elisabeth Partacius,
getauft 23.1.1682 in Insterburg.
12. Daniel Doerffer
- Pfarrer in der Gegend von Insterburg, * um 1762 in
Stallupönen, † 1717 in Ballethen. 1690
Univ.Königsberg,
Pfarrer 1699 in Didlacken, 1712 in Ballethen; oo 10.9.1699 in
Tharau
13. Anna Catharina Partacius, * um
1677, † 1714.
14. = 10.
15. = 11.
5.Generation:
16. ... Hoffmann.
Der Sohn Petrus wird 1676 in Lomp bei Preußisch Holland
geboren,
wo die Kirchenbücher schon vor 1945 nicht erhalten waren.
18. Christian Koch,
* etwa 1635, 1661-1702 Pfarrer in Stöberitz in der Mark
Brandenburg.
20. Andreas Vetter,
* 1634, † 29.5.1699 in Dinkelsbühl, Schuhmacher und
Bürger in
Dinkelsbühl.
21. Marie Leonore ...., * etwa
1645.
22. Friedrich Partacius/Partatius-
Pfarrer, * 1643 in Laukischken Kreis Labiau, † 15.4.1688 in
Insterburg. 1662 Univ.Königsberg, 1675 ordiniert in der
Königsberger Schlosskirche, Diakon und litauischer Pfarrer in
Insterburg. Dichter und Übersetzer; oo um
1676
23. Elisabeth Schütz,
* 24.10.1660, † 23.1.1746 in Tharau.
24. Daniel Doerffer,
* etwa 1640, † in Stallupönen; oo um 1673
25. Barbara ...., * etwa 1645.
26. = 22.
27. = 23.
6.Generation:
44. Johannes Partacius
- Pfarrer, * um 1610 in Reinerz/Schlesien, † ..10.1646 in
Laukischken.
1628 Univ.Königsberg. Pfarrer, erst in Trempen, ab 1641 in
Laukischken, Sprachforscher und Literat; oo 11.9.1636 in
Königsberg Dom
45. Anna Neander,
* 1619 in Tharau (südlich von Königsberg),
† 28.9.1689 in
Insterburg. Sie war das "Ännchen von Tharau" aus dem Lied von
Simon Dach.
7.Generation:
88. Matthias Partak/Partacius
- Pfarrer, * um 1570/1573 in Glatz, † 1636 in Silberberg
(bei Glatz).
1591 Univ.Leipzig, ab 1593 Schulmeister und Pfarrer in Reinerz, 1602
vertrieben (Gegenreformation), Pfarrer ab 1604 in Rothwaltersdorf, ab
1634 in Silberberg.
90. Martin Neander
- Pfarrer, * um 1588 in Schweidnitz, † 1630 in Tharau. 1604
Univ.Frankfurt/Oder, 1607 Univ.Königsberg, Pfarrer in Tharau.
91. ... Sperber,
* etwa 1590.
3. Der tote Punkt
In dieser Ahnenliste endet die Hoffmann-Stammreihe mit dem
Urgroßvater des Dichters, Petrus Hoffmann, Pfarrer in Neumark
bei
Preußisch Holland, geboren 1676 im nahegelegenen Bauerndorf
Lomp.
Über dessen Vater gab es in der Vergangenheit Diskussionen und
Fehlmeldungen, die ich kurz zusammenfassen will. Da ich selbst aus
Königsberg stamme und in meiner Ahnentafel mehrere
Hoffmann-Linien
habe, kann ich die Fortsetzung der Hoffmann-Stammreihe mitteilen.
Die Kreisstadt Preußisch Holland liegt im
ostpreußischen
Oberland, 25 km südöstlich von Elbing. Neumark liegt
15 km
nordöstlich, Lomp 22 km östlich von
Preußisch Holland.
Der bisher unüberwindliche tote Punkt in der
Hoffmann-Stammreihe
lag in Petrus Hoffmanns Geburtsort Lomp. Schon in der Vorkriegszeit
waren weder im zuständigen Pfarramt Döbern noch in
einer der
umliegenden Kirchen einschlägige Taufbücher aus
dieser Zeit
erhalten.
Das kleine Bauerndorf Lomp, ohne Kirche, ohne Schule und ohne
Herrenhaus, gehörte dem Obristen Elias v.Kanitz, der es 1670
von
dem Grafen und Burggrafen zu Dohna, der in dem nahegelegenen
Schlobitten residierte, gekauft hatte.
Aus der geringen Bedeutung des Dorfes Lomp schloss Grigoleit, dass
Petrus Hoffmanns Vater nur ein erbuntertäniger Bauer gewesen
sein
könnte. Dabei ergab sich freilich die Frage, wie der
Bauernsohn an
die Königsberger Universität kam, auf der er
("gebürtig
aus Lomp") am 28.6.1694 immatrikuliert wurde. Hierzu gab es
Vermutungen, dass der Knabe durch außergewöhnliche
Begabungen aufgefallen und von einem Gönner, vielleicht dem
Grafen
Friedrich Wilhelm v.Kanitz, gefördert worden sei.
Nun, einer solchen Spekulation bedarf es nicht.
Aus geretteten Familienpapieren kann ich die Frage nach der Herkunft
des Petrus Hoffmann beantworten. Dazu will ich freilich etwas ausholen.
Zunächst möchte ich schildern, wie genealogisches
Hoffmann-Material in mein Archiv gelangte, bevor ich auf ein altes
Manuskript von drei Königsberger Hoffmann-Forschern eingehe, das die
Klärung für E.T.A.Hoffmanns Ahnenstammreihe
enthält.
4. Meine Königsberger Hoffmann-Verwandtschaft
In Königsberg hatten wir mehrere Beziehungen zu
E.T.A.Hoffmann und seiner Familie. Die Forschungen hierzu stammen von
meinem Onkel Erich Lemmel, der im Jahre 1927 einer der ersten
Mitglieder des Königsberger Vereins für
Familienforschung in
Ost- und Westpreußen war, und von meinem Vater Gerhard
Lemmel,
der in den Monaten vor der Flucht viele seiner Urkundenregesten,
Stammfolgen und Ahnentafeln abschrieb und so vor der Vernichtung
bewahrte.
Die nebenstehende Tafel zeigt schematisch unsere Verwandtschaft mit der
Familie Hoffmann sowie einige der im Folgenden erwähnten
Personen.
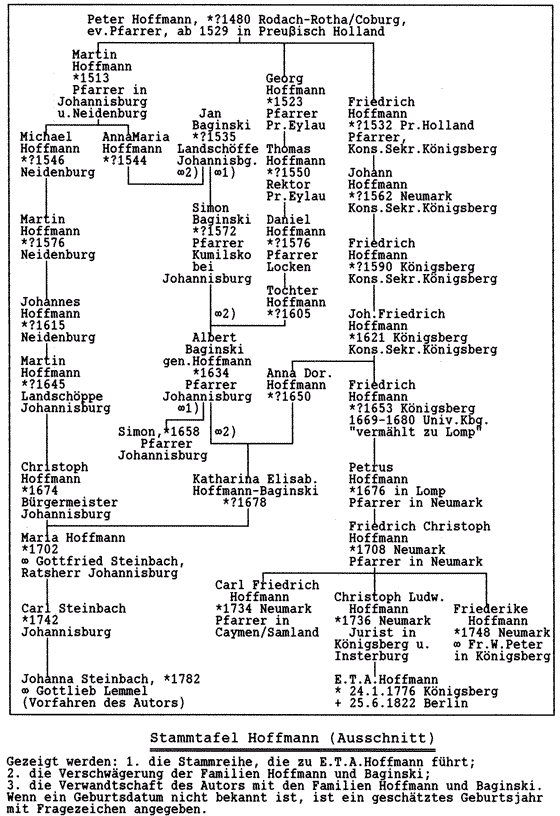
Eine meiner Vorfahren-Linien führt auf die Familie Thorun in
Caymen im Samland. Der dortige Pfarrer, der die Trauungen, Taufen und
Beerdigungen meiner Vorfahren vornahm, war ab 1768 Carl Friedrich
Hoffmann (4), E.T.A.Hoffmanns Onkel.
Eine Schwester des Caymener Pfarrers, Friederike Wilhelmine Hoffmann,
also E.T.A. Hoffmanns Tante, heiratete 1780 in der
Königsberger
Schlosskirche Friedrich Wilhelm Peter, Registrator bei der
Ostpreußischen Kriegs- und Domänenkammer in
Königsberg
(5). Meine Großmutter war eine geborene Peter, Tochter des
Gründers des damals sehr bekannten
Zigarren-Filialgeschäftes
"Carl Peter", der ebenso wie die Familie Hoffmann aus
Preußisch
Holland stammte, wo sein Vater Friedrich Wilhelm (*1796) und sein
Großvater Carl (*1756) Gastwirte waren (6).
Schließlich ist mein Vorfahr der Johannisburger Pfarrer
Albert
von Bagienski (7), geboren 1634, der den Namen "Baginski genannt
Hoffmann" annahm. Sein Vater Simon hatte zweimal geheiratet, und die
Söhne zweiter Ehe fügten ihrem Familiennamen Baginski
den
Geburtsnamen Hoffmann ihrer Mutter bei; sie war eine Tochter des
Pfarrers Daniel Hoffmann aus Preußisch Eylau, der 1599-1624
Pfarrer in Locken Kreis Osterode war (4). - Albert Baginski gen.
Hoffmann war in zweiter Ehe wiederum mit einer Hoffmann verheiratet,
Anna Dorothea, Tochter von Johann Friedrich Hoffmann in
Königsberg. - Alberts Stieftochter war Maria Wichert (oo
Andreas
Schnell, Kaufmann in Bartenstein), die wiederum eine Ahnfrau von Erich
Lemmel ist (8).
> Zudem war mein Urgroßonkel mütterlicherseits der
Schriftsteller Johann Daniel Symanski, der in Briefwechsel mit E.,T.A.
Hoffmann stand. 1821 gründete Symanski die Zeitschrift "Der
Zuschauer", wofür Hoffmann einen Beitrag lieferte (8a).< (Ergänzung 2014)
Für die Ahnenforscher unserer Familie gab es also
vielfache
Gründe, sich mit der Hoffmann-Genealogie zu
beschäftigen.
Einer der Baginski-Hoffmann-Nachkommen war der Hauptmann Theodor
Hoffmann, der 1926 90-jährig auf der Burg Berwartstein in der
Rheinpfalz lebte, wo er den Doppelnamen seiner Vorfahren, v.Bagienski
gen.Hoffmann, wieder angenommen hatte. Er hatte im Jahre 1900 eine
Stammfolge seiner Familie veröffentlicht (9), in der als
"Neumarker Zweig" auch der Neumarker Pfarrer Petrus Hoffmann mit seinen
Nachkommen, inklusive E.T.A.Hoffmann, auftaucht.
Diese genealogische Einordnung von E.T.A. Hoffmanns
Urgroßvater
Petrus war freilich falsch, ließ sich aber bis heute nicht
aus
der Welt schaffen. So heißt es in einer neueren weit
verbreiteten
E.T.A.Hoffmann-Biografie von Gabrielle Wittkop-Ménardeau
(10):
"Die Familie entstammte altem polnischen Adel, dem Haus Bagiensky, und
empfing ungarische Einsprengsel, ehe sie in den deutschen Zweig der
Hoffmann einmündete...". Das ist sicher falsch.
Schon Grigoleit zeigte 1943 (11), dass die Stammfolge des Theodor
Hoffmann-Bagienski nicht richtig sein konnte; er schreibt hierzu: "In
dieser Stammfolge wird behauptet, dass dieser Petrus Hoffmann von dem
Pfarrer Simon Hoffman gen. Bagienski (Sohn von Albert) in Johannisburg
abstamme. Wie aber sein Kind ausgerechnet in Lomp geboren sein sollte,
darüber schweigt sich Theodor Hoffmann aus. Der Ehrgeiz des
Theodor Hoffmann hat es fertig gebracht, E.Th.A.Hoffmann in den
Stammbaum der von Bagienski gen. Hoffmann einzureihen. -
Später
hat er seinen Irrtum eingesehen." Jedoch, so Grigoleit, gab es einen
späteren, ebenfalls unglaubwürdigen Stammbaum aus der
Feder
Theodor Hoffmanns, wonach "ein Sohn des Königsberger
Konsistorialsekretärs Johann Friedrich Hoffmann (1621-1681)
studiert haben und dann 'Inspektor' in Lomp geworden sein soll,
ausgerechnet in Lomp, wo nur erbuntertänige Bauern wohnten".
Hier irrt Grigoleit. Wie wir sehen werden, bedarf es nicht einer
unglaubwürdigen spekulativen Annahme eines "Inspektors in
Lomp",
um den Geburtsort des Petrus Hoffmann zu erklären.
Aber Grigoleits Ablehnung dieser Stammreihe, die er noch mit einigen
unsachlichen polemischen Anmerkungen begleitete, wurde allseits
akzeptiert, und dabei blieb es bisher. Auch H.v.Müller und
F.Schnapp (3) lassen E.T.A. Hoffmanns väterliche Stammreihe
mit
dem 1676 in Lomp geborenen Petrus Hoffmann enden.
5. Ein Manuskript von Gustav Hoffmann
Erich Lemmel (12) hatte einen Onkel zweiten Grades, Gustav
Hoffmann, Fabrikant in Königsberg, der 1944 in hohem Alter
starb.
Dieser hatte, vermutlich schon um 1920, eine Stammfolge Hoffmann
zusammengestellt, von der ich zwei Abschriften habe: die eine in Erich
Lemmels Handschrift, die andere in Schreibmaschinenschrift; letztere
wurde in den 1950er Jahren im damaligen Staatlichen Archivlager
Göttingen (13) hinterlegt.
Die Stammfolge beginnt mit Peter Hoffmann in Rodach im Coburgischen,
der 1530 als einer der ersten lutherischen Pfarrer nach
Ostpreußen ging, wo viele seiner Nachkommen an der
Königsberger Universität studierten und Pfarrer
wurden.
In dieser Zusammenstellung kommt E.T.A.Hoffmann nicht vor. Aber es
kommt vor: "Friedrich Hoffmann, * Kbg um 1653 (Fridericus H. regiomonte
prassus Dmi. Secretarii ad Reverendum Consist. Sambiense filius e
schola Loebenici cum benedictione Praeceptorii dixisti). Un.Kbg.
13.5.1669 fol.1129, 14.4.1676 fol.37, 15.4.1680 fol.78. verm. zu Lomp
Bez. Pr.Holland bei Neumark."
"Friedrich Hoffmann, vermählt zu Lomp"! Hier taucht wieder das
Dorf Lomp auf, wo E.T.A.Hoffmanns Urgroßvater Petrus Hoffmann
1676 geboren wurde. Der Königsberger Friedrich Hoffmann muss
also
sein Vater sein. Er muss, 23-jährig, am 15.8.1676 in Lomp
Vater
geworden sein, nachdem er das Sommersemester 1676 an der
Königsberger Universität verbracht hatte.
Es ergibt sich die Frage, ob Gustav Hoffmanns Manuskript in diesem
Punkt glaubhaft ist. Leider fehlen Quellenangaben; jedoch sind die
Auszüge aus der Universitäts-Matrikel mit
Seitenzahlen
versehen, so dass man annehmen muss, dass Gustav Hoffmann im Original
geforscht hat. Es ist aber nicht anzunehmen, dass die Notiz "vermählt zu
Lomp"
aus der Matrikel hervorgeht. Aus welcher anderen Quelle mag sie stammen?
Offenbar erkannte Gustav Hoffmann nicht, dass diese Notiz der
Schlüssel zur Ahnenreihe von E.T.A.Hoffmann ist, denn dieser
ist
in seinem Manuskript nicht genannt. So hatte Gustav Hoffmann sicherlich
keinen Anlass, die Notiz "vermählt zu Lomp" hier spekulativ
einzufügen, um die Abstammung E.T.A.Hoffmanns zu beweisen,
sondern
er muss diese Notiz in einer Originalquelle gefunden haben.
Es bleibt die Frage, wie der Königsberger Student Friedrich
Hoffmann zu seiner Braut in Lomp kam. Eine befriedigende Antwort kann
man Gustav Hoffmanns Manuskript indirekt entnehmen. Dort ist
ersichtlich, dass der Königsberger Friedrich Hoffmann in Lomp
praktisch zu Hause war, denn schon sein Vorfahr Johann Hoffmann wurde
um 1562 im nahegelegenen Neumark geboren, und dessen Vater Friedrich um
1532 in Preußisch Holland. Beide waren protestantische
Pfarrer,
die nach Königsberg in die Bischofskanzlei berufen wurden. Die
Königsberger Hoffmanns waren also bereits seit 150 Jahren in
der
Gegend von Preußisch Holland ansässig, so dass man
annehmen
darf, dass sie dort Verwandte hatten, zum Beispiel Nachkommen von dort
verheirateten Töchtern.
So hatte der Königsberger Student Friedrich Hoffmann
genügend
Anlass, seine Verwandten in der Gegend von Preußisch Holland
zu
besuchen und dort seine Braut zu finden. Leider kennt man nicht ihren
Namen. Ob sie die Tochter eines erbuntertänigen Bauern (nach
Grigoleit) war, sei dahingestellt. Da der Vater Friedrich zur Zeit der
Geburt des Sohnes Petrus ein 23-jähriger Student in
Königsberg war, überrascht es nicht, wenn die Geburt
in Lomp
im elterlichen Bauernhaus der Mutter stattfand.
Über den Studenten Friedrich Hoffmann ist außer
seinen
Matrikeleinträgen an der Königsberger
Universität nichts
angegeben; er ist nicht im Ostpreußischen Pfarrerbuch
genannt.
Sein Sohn Petrus Hoffmann aus Lomp besuchte 1694 die
Königsberger
Universität und bewarb sich 1707 in seiner Heimat erfolgreich
um
die Pfarrstelle in Neumark, wo er E.T.A.Hoffmanns Urgroßvater
wurde.
Nach Gustav Hoffmanns Manuskript hatte der Königsberger
Friedrich
Hoffmann eine Schwester, die schon oben erwähnte Anna
Dorothea,
geboren etwa 1650, die 1668 den Johannisburger Pfarrer und Witwer
Albert Baginski gen.Hoffmann (*1634) heiratete. Der Familienforscher
Theodor Hoffmann-Baginski hatte also nicht so ganz unrecht, wenn er in
seiner im Jahre 1900 veröffentlichten Stammfolge (9) die
Johannisburger Hoffmann-Baginskis mit E.T.A.Hoffmanns Ahnentafel
verknüpfte, wenngleich die von ihm angegebene Einordnung
falsch
war.
Nun hatte ich lange Zeit vergeblich nachgeforscht, wo die Manuskripte
von Theodor Hoffmann-Baginski verblieben sein könnten. Erst
jetzt
erfuhr ich, dass er eine knapp gefasste Hoffmann-Stammfolge (14) schon
1924 an den Magistrat zu Rodach geschickt hatte, verbunden mit dem
Vorschlag, am Rodacher Marktplatz eine Gedenktafel für Peter
Hoffmann anzubringen, und zwar anlässlich der 400-Jahrfeier
des
evangelischen Convents vom Juni 1529, an dem der Rodacher Peter
Hoffmann teilgenommen hatte, bevor er als Pfarrer nach
Ostpreußen
ging. In seinem Brief wies Theodor Hoffmann-Baginski darauf hin, dass
dieser Peter Hoffmann der Vorfahr von E.T.A.Hoffmann sei.
Die Manuskripte von Gustav Hoffmann und Theodor Hoffmann-Baginski
stimmen im Wesentlichen überein; vermutlich basieren sie auf
gemeinsamen Forschungen. Von Interesse ist hier besonders, dass Theodor
Hoffmann-Baginski über den Königsberger Studenten
Friedrich
Hoffmann ("vermählt zu Lomp") zusätzlich herausfand,
dass er
Lehrer an der Löbenichtschen Schule in Königsberg
gewesen war.
6. E.T.A.Hoffmanns Ahnenstammreihe
Die folgende Stammreihe ergibt sich nach Grigoleit (2) und
v.Müller-Schnapp (3) für die Ahnennummern 1.-8.,
sowie ab 16.
nach Gustav Hoffmanns Manuskript (13). Ehefrauen sind bei Gustav
Hoffmann nicht angegeben.
1. E.T.A.Hoffmann,
* 24.1.1776 in Königsberg, † 25.6.1822 in Berlin.
2. Christoph Ludwig Hoffmann,
* um 1736 in Neumark Kreis Preußisch Holland,
†27.4.1797 in Insterburg. 1752/1753 Univ.
Königsberg, Jurist in
Königsberg
und Insterburg.
4. Friedrich Christoph Hoffmann,
* 30.8.1708 in Neumark, † 16.6.1758 in
Tapiau. 1724 Univ. Königsberg, Pfarrer in Neumark und Tapiau.
8. Petrus Hoffmann,
* 15.8.1676 in Lomp Kreis Preußisch Holland (laut
Universitätsmatrikel und Gedenktafel in der Kirche von
Neumark), †
23.2.1726
in Neumark. 1694 Univ. Königsberg, ab 1707 Pfarrer in Neumark.
16. Friedrich Hoffmann,
* um 1653 in Königsberg. 1669, 1676, 1680 Univ.
Königsberg, "vermählt zu Lomp" (laut Gustav Hoffmanns
Manuskript), dann Lehrer
an der Löbenichtschen Schule in Königsberg (laut
Manuskript
von Theodor
Hoffmann-Baginski).
32. Johann Friedrich Hoffmann,
* 1621 in Königsberg, † 2.12.1681 in
Königsberg. 1634/1635 Univ. Königsberg,
Kurfürstlich
brandenburgischer und
preußischer Kanzlei-Taxator und Samländischer
Konsistorialsekretär in
Königsberg.
64. Friedrich Hoffmann,
* um 1590 in Königsberg. Kanzlei-Taxator und
Konsistorial-Sekretär in Königsberg (15).
128. Johann Hoffmann,
*
um 1562 in Neumark. 1581 Univ. Wittenberg als
"Neogorus", seit 1590 Kanzlei-Taxator und
Konsistorial-Sekretär in
Königsberg.
256. Friedrich Hoffmann,
* um 1532 in Preußisch Holland. 1550 Univ.
Königsberg (15), 1556-1562 Diakon in Schippenbeil, 1562-1565
Pfarrer in Groß-
Schwansfeld, dann Kanzlei-Taxator und des Bischofs
Konsistorial-Sekretär in
Königsberg (als Nachfolger seines älteren Bruders
Christoph).
512. Peter Hoffmann,
*
um 1480 in Rodach-Rotha, Coburg. 1500/1510 Univ.
Leipzig, dann in Rodach; als Zeuge des Testaments des lutherischen
Bischofs
v.Queiss genannt, der 1529 in Preußisch Holland starb; 1530
erster
lutherischer Pfarrer in Preußisch Holland. Von seinen 9
Söhnen lebten 6 in
Ostpreußen.
1024. Nikolaus Hoffmann
(16)
aus Rodach, 1471 Univ. Leipzig.
7. Weitere Namensträger Hoffmann
Ich möchte nun noch auf einige weitere der vielen
Pfarrer
namens Hoffmann hinweisen, die im Ostpreußischen Pfarrerbuch
(4)
erwähnt sind, ohne dass bisher eine Verwandtschaft mit der
E.T.A.Hoffmann-Sippe festgestellt werden konnte.
In Döbern, wo E.T.A.Hoffmanns Urgroßvater 1676
getauft
wurde, gab es bereits 100 Jahre früher einen Pfarrer George
Hoffmann, der 1550 zusammen mit seinem mutmaßlichen Bruder
Johann Hoffmann in Königsberg studierte, wobei Strehlen in
Schlesien als ihr Geburtsort angegeben ist.
Ferner gibt es einen Pfarrer Sebastian Hoffmann, der gleichzeitig mit
dem Rodacher Peter Hoffmann zu den ersten lutherischen Pfarrern des
Herzogtums Preußen gehörte. Er amtierte 1528-1530 in
Petersdorf und 1530-1534 in Alt-Wehlau, beides im Kirchenkreis Wehlau
(zwischen Königsberg und Insterburg).
8. Schlussbemerkung
Somit entstammt E.T.A.Hoffmann einer der ältesten
lutherischen Pfarrerfamilien Ostpreußens, deren Stammvater
bereits kurz nach der Reformation aus dem Coburgischen nach
Ostpreußen kam.
Als 1525 der letzte Hochmeister des Deutschen Ordens, Albrecht von
Hohenzollern, den Ordensstaat in ein evangelisches Herzogtum
umwandelte, muss Peter Hoffmann aus dem Coburgischen Rodach-Rotha eine
führende Rolle gespielt haben. Im Juni 1529 gehörte
er in
Rodach zu den Mitautoren der "Rodacher Artikel", die eine wichtige
Basis für die Verteidigung des neuen Glaubens bildeten (17).
Noch
im selben Jahr reiste er nach Preußen, wo er als
Unterzeichner
des Testaments des evangelischen Bischofs v.Queiß belegt ist,
der
am 8.9.1529 in Preußisch Holland starb. Hier wurde Peter
Hoffmann
1530 der erste lutherische Pfarrer an der Bartholomäuskirche.
 [Postkarte,Verlag
Rautenberg]
[Postkarte,Verlag
Rautenberg]
Pr.Holland,
Rathaus und Turm der Bartholomäuskirche.
Peter Hoffmann hatte neun Söhne, von denen sechs in
Ostpreußen lebten. Zu den Nachkommen gehört eine
Reihe von
ostpreußischen Pfarrern und Rektoren, und die
Königsberger
Universitäts-Matrikel enthält zahlreiche
Hoffmann-Einträge, von denen viele, freilich nicht alle, den
Nachkommen von Peter Hoffmann zuzuschreiben sind.
Ab 1565 gab es mehrere Verschwägerungen mit der Johannisburger
Familie v.Bagienski, so dass die späteren Baginski
gen.Hoffmann in
weiblicher Linie von Peter Hoffmann abstammen.
Eine Hoffmann-Linie war durch 3 Jahrhunderte in und um
Preußisch
Holland ansässig, blieb aber gleichzeitig mit dem Herzog in
Königsberg in enger Verbindung. Dort blieb das doppelte Amt
des
preußischen Kanzlei-Taxators und des bischöflichen
Konsistorial-Sekretärs durch einige Generationen in der
Familie
Hoffmann. Aus dieser Linie stammt E.T.A.Hoffmann, dessen
väterliche Ahnen also seit Beginn des lutherischen Herzogtums
Preußen durch neun Generationen Pfarrer und Juristen im Kreis
Preußisch Holland und in Königsberg waren.
Nachträgliche Kritik
Nach der Veröffentlichung wurde ich 2003 von Herrn
Carsten Fecker,
Verein für Familienforschung in Ost- und
Westpreußen, auf
einige Unsicherheiten hingewiesen.
1. Die Person des um 1653 geborenen Friedrich Hoffmann ist urkundlich
wenig gesichert. In der Universitätsmatrikel gibt es drei
Einträge auf den Namen Friedrich Hoffmann: 1669, 1676, 1680,
die vielleicht nicht die selbe Person betreffen.
2. Die Herkunft von Erich Lemmels Notiz "verm. zu Lomp" ist unbekannt. Sie stammt sicher nicht aus der
Universitätsmatrikel. Sollte sie eher als "vermutlich
zu
Lomp" zu deuten sein? In den handschriftlichen Notizen,
die ich von Erich Lemmel erhielt, ist die Abkürzung "verm."
häufig und steht eindeutig für "vermählt". Die Deutung
als "vermutlich" ist auszuschließen. Aber da die Quelle für
die Notiz "verm. zu Lomp" unbekannt ist, bleibt sie zweifelhaft.
3. Der Vater des 1676 in Lomp geborenen Petrus Hoffmann bleibt also weiter
unsicher. Die von mir mitgeteilte Stammreihe ist eine sehr wahrscheinliche, aber nicht gesicherte Lösung.
4. Außer dem Dorf Lomp, Kirche Döbern im Kreis
Pr.Holland,
gibt es in nur 20 km Entfernung das Gut Lomp im Kreis Mohrungen. Hier
wurde noch nicht geforscht.
H.D. Lemmel, Mai 2003, erg.Jan.2021
Quellen und Anmerkungen
(1) Peter Härtling: Hoffmann oder die vielfältige
Liebe.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2001.
(2) Eduard Grigoleit: Ahnentafel des Dichters Ernst Theodor (Amadeus)
Wilhelm Hoffmann. In: Ahnentafeln berühmter Deutscher,
5.Folge,
1943, Seiten 194-200.
(3) Hans v.Müller, Friedrich Schnapp (Hrsg.): E.T.A. Hoffmanns
Briefwechsel, Bd.3, Winkler-Verlag München 1969, Seiten
373-383.
(4) Altpreußisches evangelisches Pfarrerbuch. Band 1
herausgegeben von Friedwald Moeller Hamburg 1968, Sonderschrift Nr.11
des Vereins für Familienforschung in Ost- und
Westpreußen.
Dieser Band enthält nur die Kirchspiele und ihre
Stellenbesetzungen. Von dem unveröffentlichten
ausführlichen
Manuskript mit detaillierten Angaben zu Lebenslauf und Familie lagen
mir in Kopie die Seiten mit den Namensträgern Hoffmann vor. -
Die
Daten basieren auf den älteren Pfarrerbüchern von
Daniel
Heinrich Arnoldt, Königsberg 1777, und Ludwig Rhesa,
Königsberg 1834, nebst zahlreichen Ergänzungen aus
verschiedenen Quellen.
(5) Adresskalender Königsberg 1784, laut Gerhard Lemmel 1935.
(6) Hans-Dietrich Lemmel: Ahnenliste Carl Peter (*1835 in Pr.Holland),
1983. AL10506 in der Deutschen Zentralstelle für Genealogie in
Leipzig. - Hans-Dietrich Lemmel: Familiengeschichte Peter, Manuskript
in Arbeit.
(7) Hans-Dietrich Lemmel: Ahnenliste Carl Lemmel (*1812 in
Johannisburg), 1983. AL10503 in der Deutschen Zentrastelle für
Genealogie in Leipzig. - Vergl. Hans-Dietrich Lemmel: Die Herkunft der
ostpreußischen Familien Steinbach und Lemmel, in: Altpr.
Geschl'kde 19.Jg. 1971 S.323-332. - Zu Albert Hoffmann gen. Baginsky
siehe auch Reinhold Ulkan: Ahnenliste Ulkan; in: Altpr. Geschl'kde
Fam'archiv Nr.59 (1976). Siehe auch Günter Boretius: Die
Familie
Hoffmann genannt Baginski; in: Altpr. Geschl'kde Fam'archiv Nr.77
(1985) S.150. Siehe auch Richard Riemann: Ostmärkisches Blut;
Gräfe und Unzer, Königsberg 1936, S.158ff.
(8) Ahnenliste Erich Lemmel, nicht veröffentlicht.
(8a) Andreas Olbrich, Das literarische Werk E.T.A. Hoffmanns in der zeitgenössischen Kritik, Promotion Paderborn 2008.
(9) Theodor Hoffmann (später: v.Baginski gen.Hoffmann):
Stammfolge
Baginski-Hoffmann. Genealogisches Handbuch Bürgerlicher
Familien,
Bd.7, Berlin 1900, S.163-175.
(10) Gabrielle Wittkop-Ménardeau: E.T.A. Hoffmann. rororo
Bild-Monographien Bd.113, 1966, 15. Auflage 1998, S.8.
(11) Grigoleit (2), Fußnote 36.
(12) Reinhold Heling: Erich Lemmel 95 Jahre alt; in: Altpr. Geschl'kde
33.Jg. (1985) Bd.15, S.480.
(13) Staatliches Archivlager Göttingen, Sammlung Friedwald
Moeller, Manuskript "Die Hoffmann, nach Herrn Hauptmann v.Baginski gen.
Hoffmann. Auszug bzw. Abschrift nach einer Stammtafel von Gustav
Hoffmann, +1944, Fabrikbesitzer einer Bindfadenfabrik in
Königsberg." Mit einem Anhang: "Kritische Betrachtungen zur
Stammfolge Hoffmann, von Friedwald Moeller, Wiesbaden, 1956. - Die
Zusammenstellung habe ich von Oberst a.D. Lemmel, Wiesbaden, zur
Abschrift erhalten."
(14) Theodor von Baginski genannt Hoffmann: Manuskript "Hoffmann" mit
Begleitbriefen, 1924; Stadtarchiv Bad Rodach Nr.312-322; Mitteilung vom
20.3.2001. Dem Stadtarchiv danke ich für die freundliche
Überlassung der Fotokopie.
(15) Der 1590 geborene Friedrich Hoffmann fehlt in Gustav Hoffmanns
Manuskript, das den 1621 geborenen Johann Friedrich als Sohn des um
1562 geborenen Johann Hoffmann angibt. Reinhold Ulkan, ein weiterer
Hoffmann-Nachkomme und Hoffmann-Forscher, mit dem ich 1978 konferierte,
wies darauf hin, dass man für den Zeitraum des urkundlichen
Konsistorial-Sekretärs Friedrich Hoffmann zwei Personen
annehmen
müsse, nämlich einen um 1590 geborenen Friedrich und
den 1621
geborenen (Johann) Friedrich. Freilich wurde für einen um 1590
geborenen Friedrich Hoffmann kein Eintrag in einer
Universitäts-Matrikel gefunden. - Ebenso wie Ulkan auch im
Rodacher Manuskript von Theodor Hoffmann-Baginski. - Für den
um
1532 geborenen Friedrich Hoffmann ist in Gustav Hoffmanns Manuskript
kein Universitätsbesuch angegeben. Die Notiz "Albertina
7.8.1550"
wurde von Reinhold Ulkan nachgetragen.
(16) Laut Theodor Hoffmann-Baginski. - Gustav Hoffmann hatte als Vater
des Rodacher Peter einen Christoph Hoffmann aus Coburg, 1465 Univ.
Leipzig, angegeben, Sohn eines Hans Hoffmann, * 1392 in Meiningen.
(17) Erich Lemmel, Aufzeichnungen aus der Rodacher Stadtchronik.
(18) vergl. Hans-Dietrich Lemmel: Beiträge zu Copernicus und
seiner Verwandtschaft, in: Genealogie, Heft 1-2 1993, S.385-406.
Presse-Echo:
Neue Presse Coburg, 3.4.2002
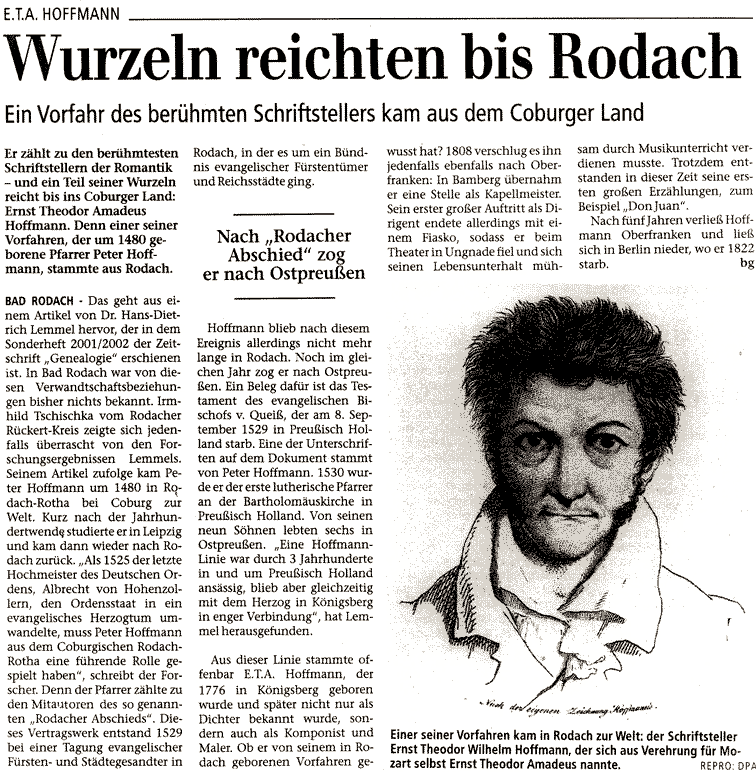
Ende
Zurück zum Index
Zur Stammtafel der Familie Hoffmann in Ostpreußen
 [Postkarte,Verlag
Rautenberg]
[Postkarte,Verlag
Rautenberg] Das
E.T.A.Hoffmann-Denkmal in Bamberg
Das
E.T.A.Hoffmann-Denkmal in Bamberg
 Simon Dach [aus
Schumacher: Geschichte Ostpreußens, Rautenberg 1957]
Simon Dach [aus
Schumacher: Geschichte Ostpreußens, Rautenberg 1957]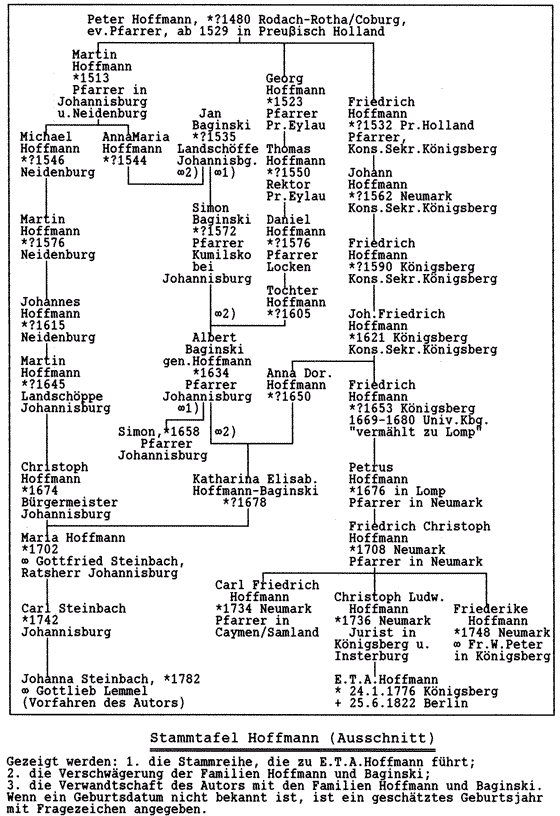
 [Postkarte,Verlag
Rautenberg]
[Postkarte,Verlag
Rautenberg]