 Ernst Lemmel, zu
seinem 100sten Geburtstag
Ernst Lemmel, zu
seinem 100sten Geburtstag 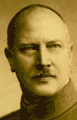
aufgeschrieben von seinem Sohn Heinz Lemmel am 7.2.1966 in Lüneburg
(Anfang 2016 - es war zufällig Großvater Ernsts 150ster Geburtstag - tippte ich Onkel Heinzens Kohledurchschlag-Skriptum in den Computer und fügte Illustrationen hinzu. Einige Text-Ergänzungen, die ich einfügte, sind mit •Punkten• gekennzeichnet. - Hans-Dietrich Lemmel)










 Ernst
Wilms [wikipedia]
Ernst
Wilms [wikipedia]














