Hier eine besonders schöne Ausführung dieses Wappens.

 Gebwin und Volmar Lemelin1358
[Stadtarchiv
Schwäbisch Hall,
Urk. vom 27.11.1358, Heilbronn]
Gebwin und Volmar Lemelin1358
[Stadtarchiv
Schwäbisch Hall,
Urk. vom 27.11.1358, Heilbronn] Volmar Lemlin
1464
Volmar Lemlin
1464


















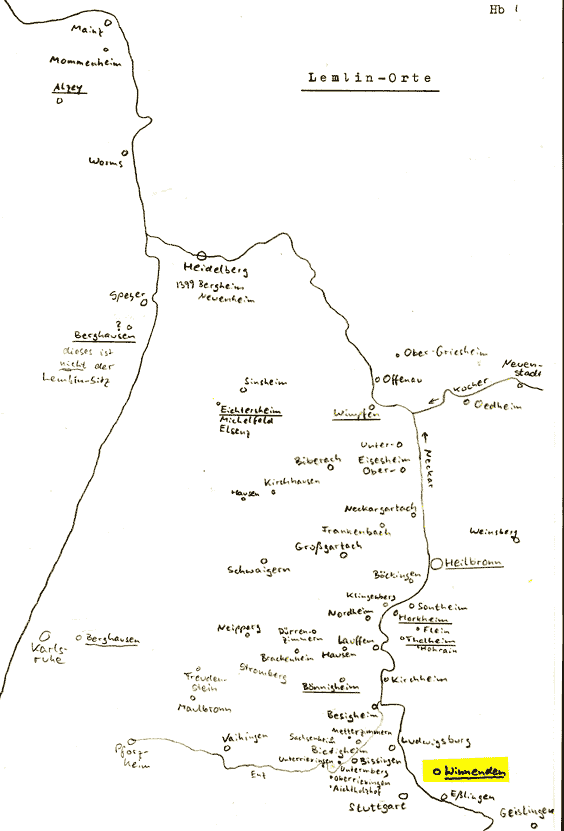







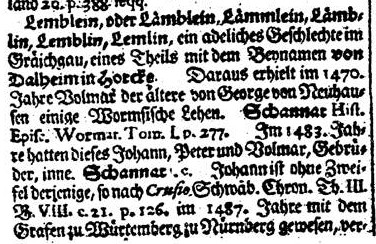

|
┌──────────────────┐ Hartmut 1291 Volmar 1291 * etwa ?1225/1240 │ ├────────────────────┐ Hartmut d.J. 1298 Heinrich 1298 * etwa ?1260/1270 |
|
Brüder erwähnt
1291
Brüder erwähnt 1298 ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ Hartmut Volmar Hartmut Heinrich |
|
Brüder ┌─────────────────────┬───────────────┐ Hartmut │ │ *?1240 Heinrich │ urkundlich 1281-1303 *?1245/50 Volmar │ urk.1285-1318 *?1250/60 │ urk.1290/1291 Hartmut iun. │ * um 1270 │ † vor 1297 Volmar, *?1290 Richter |
| Volmar Lemlin, *?1250/60 │ Volmar Lemlin, *?1290, Richter │ Volmar Lemlin, *?1320 │ Volmar Lemlin, *?1355, Richter oo1) vor 1384 oo2) um 1420 │ │ Volmar d.Ä │ *?1385 Volmar d.J. *?1425 |
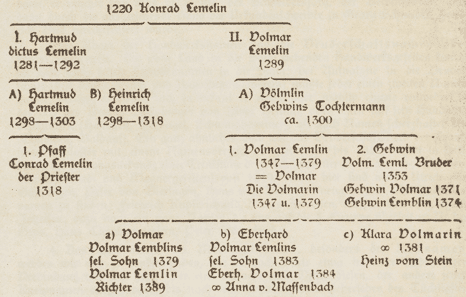

 Im Siegel: "S Eberhardi dci
(=dicti) Wolmar",
in der Urkunde: "Eberhart
Volmar Lemlyns selige Sun von heilprune".
Im Siegel: "S Eberhardi dci
(=dicti) Wolmar",
in der Urkunde: "Eberhart
Volmar Lemlyns selige Sun von heilprune".
|
25/a Volmar Lemlin *?1355, †1429/1430 Richter in Heilbronn Böllingen, Wimpfen u.a. oo1)v.Massenbach oo2)v.Thalheim ┌────────────┘ └─────────────┐ 26/b Volmar Lemlin d.Ä. │ *?1385, †1476 │ 1457 Gutsbesitz in Horkheim │ um 1459 Burg Horkheim als freier Besitz 26/g Volmar Lemlin d.J. 1461 Burg Horkheim als pfälzer Lehen *?1425, † zw.1489/1494 (1464 auch im Namen der Brüder) zu Eichtersheim │ 1487 Gutsbesitz in Thalheim Brüder 1483│Burg Horkheim │ ┌─────────────┼─────────────┐ │ 27/a │ │ ┌──────────────────┤ Hans 27/b Peter 27/c 27/g Hans │ *?1455 *?1460, †1501 Volmar *?1460, †n.1537 27/h Volmar Burg 1482/1483 Verkauf *1462 zu Bönnigheim *?1465, †1510/1511 Alzey von Gütern in 1511 Burg Horkheim 1498 "zu Thalheim" †nach Horkheim als Vormund der 1501,1507 Ganerbe Thalheim 1483 │ Neffen 1509 Burg Horkheim │ │ │ │ │ Brüder 1511│Burg Horkheim │ ┌──────────────────┼────────────────────┐ 28/b Hugo/Haug Philipp │ │ *?1490, †1556 *?1492,†n.1511 28/g Volmar │ │ *?1495, †1568 28/h Hans │ 1523 "Lemlin v.Horkheim" *?1505, †1532 │ 1533 Burg Horkheim nach 1526 Ganerbe │ Tod der Brüder Thalheim │ 1542 Ganerbe Thalheim 29/b Veltin 1563 baut er die Begräb- *?1525, †1569 niskapelle in Horkheim zu Berghausen │ │ Brüder 1572 Gan│erben Thalheim │ ┌────────────┴───────────┐ │ 29/g Gottfried 29/h Philipp │ *?1540, †vor1582 *?1540, †1595 30/b Philipp Christoph 1561 Adelssitz Thalheim 1571 "zu Horkheim" *?1555, †1596 1569 Burg Horkheim 1585 Horkheim 1571 unmündig, sein Vor- kein Sohn 1585/1587 Ganerbe mund: 29/h Philipp Thalheim verkauft 1582 Adelssitz Thalheim kein Sohn 1595 Burg Horkheim │ 31/b Georg Valentin *?1582, †nach1626 1596 Adelssitz Thalheim, verkauft 1606 1596 Burg Horkheim, verkauft 1622 │ Georg Friedrich, †1605 als Kind, begraben in Horkheim |
 Links: Lemblin von
Rennertshofen, rechts: Lemblin von Thalheim
Links: Lemblin von
Rennertshofen, rechts: Lemblin von Thalheim
