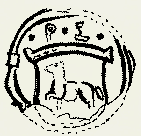zurück
zum Haupt-Index
zum Lemmel-Sachsen-Index
Die
Chemnitzer Lemmel seit
1427
Von Hans-Dietrich Lemmel
Vortrag am Familientag 2000.
Ursprünglich gedruckt in "lemlein filii" Heft 6, 2001, seither
unwesentlich ergänzt.
Eine gekürzte Fassung wurde gedruckt in "Familie und
Geschichte"
Band 4, 2002, Seiten 241-249 und 315-324.
Dieser Text enthält den am Familientag
gehaltenen
Vortrag,
mit einigen Kürzungen und einigen Ergänzungen. In einem separaten Text werde ich die sächsischen Lemmel-Urkunden des 15.
Jahrhunderts im einzelnen besprechen.
1. Einleitung
Chemnitz ist der Ursprungsort der meisten Lemmel und Lämmel,
und
so ist es mir eine grosse Freude, dass der Familientag 2000 hier in
Chemnitz abgehalten wurde.
Der besondere Dank der gesamten Lemmel/Lämmel-Familie
gebührt
dem örtlichen Organisator Klaus Lämmel; unserem
Gastgeber
Thomas Lämmel in der Schlossgaststätte Lichtenwalde;
meiner
Kusine Inge Höfler-Lemmel, die traditionelle Leiterin unseres
Familienverbandes seit dem ersten Treffen vor mehr als 30 Jahren; sowie
zahlreichen Familienangehörigen, die selbst Familienforschung
betrieben und wertvolles Material beigetrugen.
Am letzten Familientag in Dresden sprach ich über die Familie
Lemmel unter August dem Starken (1) und seinem Finanzexperten, dem
General-Kriegszahlmeister Johann Lämmel in Dresden.
Natürlich
kam auch er aus Chemnitz.
Heute will ich etwas über die Chemnitzer Lemmel vortragen, und
dabei werde ich wieder einige Geschichten aus der Familienchronik
erzählen. Die schönsten Lemmel-Geschichten kennen Sie
ja
schon gedruckt in den "lemlein filii"-Heften, aber es gibt noch einiges
mehr.
Voranstellen möchte ich eine Übersichtstafel,
aus der die wichtigsten Lemmel/Lämmel meines Vortrages und
ihre
Verwandtschaft ersichtlich sind.
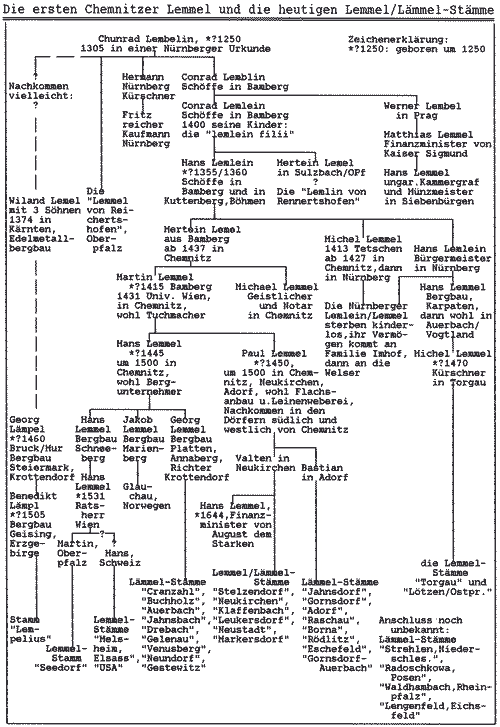
Obenan finden wir Chunrad Lembelin, unseren Stammvater, der um 1300 in
Nürnberg lebte (2).
Ganz unten sind die heutigen Lemmel- und
Lämmel-Stämme
angegeben (3). Es sind nur die Stämme eingetragen, von denen
jemand beim Familientag anwesend war. (Es gibt noch eine ganze Reihe
von weiteren Lemmel/Lämmel-Stämmen!) Die Teilnehmer
erhielten
alle ihre persönliche Ahnenliste
ausgehändigt, so dass jeder wusste, zu welchem
Lemmel/Lämmel-Stamm er gehört.
In der Mitte der Tafel findet man die beiden Martin Lemmel, Vater
und
Sohn, die um 1450 in Chemnitz lebten, und von denen fast alle
sächsischen Lemmel und Lämmel abstammen.
Rings herum habe ich in der Tafel einige der Personen angegeben, die
ich in meinem Vortrag erwähnen werde.
2. Die ersten Chemnitzer Lemmel und die
Ausbreitung
ihrer Nachkommen
Im Jahre 1427 wird der erste Lemmel Bürger in Chemnitz. Das
war
vor mehr als einem halben Jahrtausend.
Um 1480 leben die beiden Brüder Paul und Hans Lemmel
in Chemnitz
und im südlich angrenzenden Neukirchen.
100 Jahre später, um 1580, leben bereits über 60
Männer
namens Lemmel in Chemnitz und im Erzgebirge.
Heute gibt es in Sachsen mehr als 250 Lemmel/Lämmel-Adressen,
die
wohl an die 1000 Personen betreffen.
Ursprünglich hatte man annehmen müssen, dass der Name
Lemmel,
der ein kleines Lamm bedeutet, mehrmals unabhängig entstand,
so
dass nicht alle Träger dieses Namens mit einander verwandt
sein
müssen. Das ist im Prinzip richtig, und es gibt in Sachsen
tatsächlich mehrere Lemmel-Stammväter. So stammen die
Torgauer Lemmel nicht vom ersten Chemnitzer Lemmel ab.
Aber es sind die Chemnitzer Lemmel, die sich so stark vermehrten, dass
die wenigen Lemmel anderer Herkunft zahlenmässig kaum ins
Gewicht
fallen.
Wenn man nur die Stammhalter-Nachkommen betrachtet, also nur die
männlichen Nachkommen, die den Namen Lemmel tragen, dann zeigt
sich folgendes:
Von den beiden Chemnitzer Lemmel-Brüdern, die um 1500 lebten,
hatte
- Hans Lemmel:
4 Söhne, 9 Enkel, 35 Urenkel;
- Paul Lemmel:
6 Söhne, 12 Enkel, 29 Urenkel;
und das trotz einiger Missgeschicke. So wurde 1535 ein Lemmel-Sohn in
Neukirchen ermordet, und der hätte vielleicht auch noch 30
Urenkel
haben können.
Einige der späteren Nachkommen konnten mithalten.
- Christian
Lemmel, um 1740 Bauer in Gornsdorf: Er hatte 3
Söhne, 9 Enkel, 23 Urenkel;
- Lorenz
Lämmel, um 1800 Häusler in Borna bei
Chemnitz:
6 Söhne, 13 Enkel, 30 Urenkel;
- Christian
Friedrich Lämmel, um 1840 Wirt und Maurer in
Neundorf bei Annaberg: 5 Söhne, 13 Enkel, 27 Urenkel.
Wohlgemerkt: Hier wurden nur die Söhne und die Söhne
der
Söhne gezählt. Zusammen mit den
Töchterkindern ergibt
sich ein Vielfaches an Nachkommen.
1839 stirbt in Chemnitz im Alter von 93 Jahren Johann George
Lämmel, ein Auszugsbauer aus Borna, und
hinterlässt eine
lebende Nachkommenschaft von 168 Personen, nämlich 5 Kinder,
50
Enkel, 97 Urenkel und 16 Ururenkel. So steht es als
denkwürdiges
Ereignis in einer Chemnitzer Chronik (4). - Hier wurden die
Töchter und Töchterkinder mitgezählt, jedoch
nicht die
schon zuvor gestorbenen Nachkommen.
3. Vom Mittelalter zur
Neuzeit: Die
Bürokratie
Zurück zu den ersten Chemnitzer Lemmeln im 15. Jahrhundert. In
der
Zeit um 1500 gab es bedeutende Umwälzungen. Es war der
Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, der Beginn von
Renaissance
und Reformation.
Copernicus entdeckt, dass die Erde sich um die Sonne dreht.
Columbus entdeckt Amerika.
Veit Stoss, Albrecht Dürer, Lucas Cranach und andere schaffen
neuartige Kunstwerke.
Martin Luther übersetzt die Bibel.
Gutenberg erfindet den Buchdruck.
Mehr und mehr Leute lernen lesen und schreiben, und Adam Riese bringt
ihnen das Rechnen mit arabischen Zahlen bei.
Und vieles andere.
Hinzu kommt eine Umwälzung, die die Familiengeschichte direkt
betrifft: Man erfindet die Bürokratie. Nur der
Bürokratie ist
es zu verdanken, dass wir die Geschichte der Chemnitzer Lemmel heute
genau kennen, dass wir über (fast) jeden einzelnen Lemmel
schriftliche Dokumente vorfinden.
Zuvor, im Mittelalter, wurde aus dem täglichen Leben kaum
etwas
aufgeschrieben. Vieles wurde nur mündlich verhandelt und durch
Zeugen beglaubigt.
Nun wurde es anders, die Neuzeit beginnt. In Chemnitz wurde um 1425 das
erste Bürgerbuch angelegt, in das die neu zugezogenen
Bürger
eingetragen wurden, darunter auch 1427 "Lemel" und 1437 "Lemel der
elder".
Etwas später, um 1500 und danach, gibt es Steuerverzeichnisse,
in
denen alle Bürger eines Ortes verzeichnet sind, die einen
steuerpflichtigen Besitz haben. Aus den eingetragenen
Steuer-Beträgen kann man entnehmen, ob einer reich oder arm
ist.
Aus diesen Steuerlisten kann man verfolgen, wann und wo in Sachsen,
vorwiegend im Erzgebirge, die ersten Lemmel auftauchen.
Dann werden Gerichtsbücher angelegt, in denen
Kaufverträge
und Erbschaftssachen eingetragen werden. Dabei ist es ein besonderer
Glücksfall, dass es in Neukirchen bei Chemnitz eines der
frühesten dörflichen Gerichtsbücher gibt,
das bereits
1491 beginnt; und es ist wiederum ein Glücksfall, dass die
Chemnitzer Lemmel um 1500 ausgerechnet nach Neukirchen
übersiedeln, wo ihre Erbschaftsregelungen im Gerichtsbuch
verzeichnet sind. Während man in den Steuerverzeichnissen nur
die
Namen findet, nicht aber: "Wer ist der Sohn von wem?", sind in den
Gerichtsbüchern, besonders in Erbschaftssachen, ganze Familien
und
Verwandtschafts-Beziehungen zu erkennen.
Schliesslich dringt um 1550 die Bürokratie auch bis zur Kirche
durch: Die Kirchenbücher werden angelegt, in denen alle
Trauungen,
Taufen und Todesfälle verzeichnet sind. Danach kann man die
Lemmel-Familien lückenlos rekonstruieren, sofern nicht die
Kirchenbücher im 30-jährigen Krieg oder im 2.
Weltkrieg
verbrannten.
Um die Geschichte der sächsischen Lemmel/Lämmel zu
erforschen, wurden von etlichen Forschern hunderte von
Gerichtsbucheinträgen im Staatsarchiv Dresden abgeschrieben
und
viele tausend Kirchenbucheinträge aus zahllosen
sächsischen
Kirchen (5).
Dazu haben viele Familienforscher beigetragen. Besonders
erwähnen
möchte ich Herbert
E. Lemmel, der erstmals über die Herkunft
der Chemnitzer Lemmel aus Bamberg berichtete; den Dresdener Genealogen
Kurt Wensch,
der die Urkundenabschriften aus dem Dresdener
Staatsarchiv besorgte; Rolf
Windisch in Freiberg, der zahllose
Kirchenbücher durchsah; und meinen Vater Gerhard Lemmel, der
unserer Familiengeschichte in vielen Bibliotheken und Archiven
nachspürte.
Der Umbruch vom Mittelalter zur Neuzeit wurde wesentlich von den
Kaufleuten einiger deutscher Städte getragen. Hier hatten
einige
wenige führende Familien das Regiment, und hier konnten sich
die
Tüchtigsten und Einfallsreichsten durchsetzen und ihre
Aktivitäten entfalten. Führend waren im Norden die
Hansestädte, im Süden Augsburg, Regensburg und
Nürnberg.
Die bekanntesten und erfolgreichsten Unternehmer-Familien waren die
Fugger und Welser in Augsburg.
Die Stammväter dieser Familien
waren um 1300 bescheidene Bauern und Handwerker. Ursprünglich
bauten sie Flachs an, webten Leinentuche und brachten diese zum Markt.
Ihre besonderen Fähigkeiten entwickelten sie durch gekonnte
Vermarktung, durch Erfinden von verbesserten Techniken, und durch das
Erlernen des in den italienischen Städten schon
früher
entwickelten modernen Geldwesens, das den Handel vereinfachte und
profitabler machte.
Das in Produktion und Handel verdiente Geld verwendeten sie im Bergbau
in den Alpen und Karpaten. Für den Bergbau erfanden sie
verbesserte Techniken, so dass sie innerhalb weniger Generationen ein
beträchtliches Vermögen anhäufen konnten.
Um 1500 waren die Fugger und Welser bereits die wichtigsten Geldgeber
für die Habsburger Kaiser Maximilian den I. und Karl den V.
und
konnten dadurch deren Politik mitbestimmen.
Warum erzähle ich dieses? Weil die Lemmel in
Nürnberg,
Bamberg und Chemnitz am Umbruch vom Mittelalter zur Neuzeit ebensolche
Unternehmer waren wie die Fugger und Welser. Nur war ihr Erfolg weniger
dauerhaft.
4. Die Lemlein in Nürnberg und Bamberg
Über unsere Vorfahren in Nürnberg und Bamberg ist
wenig
überliefert. Es war ja noch Mittelalter, es gab noch keine
Bürokratie, und der auch damals notwendige Schriftwechsel
wurde
nicht aufgehoben; nur weniges findet sich noch in den heutigen
Archiven. Daher erfordern die spärlichen schriftliche
Dokumente
vor 1500 eingehende Studien und Kombinationen, um aus den wenigen
Fakten die Familiengeschichte zu rekonstruieren.
Um 1280/1300 lebte in Nürnberg unser aller Stammvater, Chunrad
Lembelin (2, 18). Der Familienname "Lembelin" ist
mittelhochdeutsch;
später wurde er zum neuhochdeutschen "Lemlein" und
"Lämmlein"
abgewandelt, und schließlich zu "Lemmel" und
"Lämmel". Vom
Stammvater Chunrad Lembelin ist nur der Name bekannt. Aber in den
wenigen erhaltenen Urkunden steht die Familie in engem Zusammenhang mit
den Nürnberger Familien Stromer
und Holzschuher,
die damals die
wichtigsten Handelsunternehmer stellten. Was die Fugger und Welser
für Augsburg waren, waren die Stromer und Holzschuher
für
Nürnberg. Und die Nürnberger Lemlein waren ihre
Handelspartner (6).
Der erste Nürnberger Lemlein, über den aus einer
Urkunde
hervorgeht, womit er handelte, war ein Kürschner, der Felle
verarbeitete und mit Pelzen handelte. Die zufällig erhaltene
Urkunde sagt freilich nur aus, dass er mit einem Farbstoff handelte,
der beim Gerben verwendet wird.
Sein Sohn, Fritz
Lemlein, scheint ein Bergwerk in der Gegend
von Eger
betrieben zu haben. Aber das war sicher nur ein kleiner Teil seines
Unternehmens. Er war bereits so reich, dass er sein Vermögen
im
Geldverleih vermehrte und dabei von einem Schuldner eine ganze Burg,
den Wolfstein bei Neumarkt in der Oberpfalz, zum Pfand erhielt. Leider
wurde das Pfand wieder ausgelöst, und er musste die Burg
wieder
abgeben. Aber in der Nähe erwarb ein Vetter einen Besitz in
Reichertshofen, so dass die Nachkommen als "Lemmel von Reichertshofen"
zum oberpfälzer Adel zählten.
Ähnlich wie später die Fugger und Welser traten auch
die
Lemmel in die Dienste von Königen und Kaisern (7). Mathias Lemmel
war um 1380 in Prag in der Finanzverwaltung Kaiser Karls des IV., und
später, bis 1426, war er der Schatzmeister (also
Finanzminister)
von Kaiser Siegmund. Sein Sohn Hans
Lemmel wurde Graf und
Münzmeister in Hermannstadt in Siebenbürgen.
1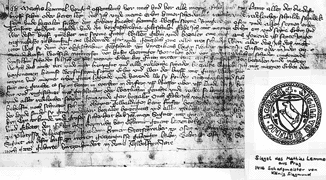 2
2 3
3
1: Urkunde und Siegel von Mathias Lemmel, 1416
2: Hans Lemmel, Graf zu Hermannstadt, 1439
3: Hans Lemlein, Bamberg 1406
Sein Vetter war Hans
Lemlein in Bamberg (8), der für uns eine
besondere Bedeutung hat: Im Jahre 1406 schließt er mit seinen
Brüdern, nach dem Tod der Eltern, einen Erbvertrag. Darin sind
die
Brüder als die "lemlein
filii" bezeichnet, und Hans Lemleins
Siegel unter dem Vertrag zeigt erstmals das Lemlein-Wappen mit je einem
Lamm im Schild und auf dem Helm. Dieser Hans Lemlein aber war der Vater
der beiden ersten Chemnitzer Lemmel.
Hans Lemlein lebte zeitweilig in Kuttenberg in Böhmen, das
damals
ein wichtiges Zentrum des Edelmetall-Bergbaus war. Die Kuttenberger
Kupferbarren wurden über die Elbe verschifft, und in Tetschen
an
der Elbe saß Hans Lemleins Sohn Michel Lemmel,
vermutlich um
für
den Verkauf und Transport der Metallwaren zu sorgen. Über ihn
ist
eine seltsame Urkunde erhalten. Er ist im Jahre 1413 in einen Konflikt
mit der Stadt Freiberg verwickelt, wo man ihn als einen Strauchdieb
bezeichnete und ihn gehangen hätte, wenn man ihn gefangen
hätte. Das ist die erste sächsische Lemmel-Urkunde.
In der Folge gerieten die Bamberger Lemlein in zwei politische
Konflikte, die ihr weiteres Schicksal bestimmte.
1. In Prag reformierte Jan Hus die tschechische Kirche. Papst und
Kaiser konnten das nicht dulden. Kaiser Siegmund, dessen Schatzmeister
Mathias Lemmel
war, lud Jan Hus zum Konzil nach Konstanz. Obgleich er
ihm freies Geleit zugesagt hatte, wurde Jan Hus 1415 als Ketzer
verbrannt. Nach diesem eklatanten Unrecht wurde die hussitische
Bewegung kriegerisch, und der Kuttenberger Hans Lemlein und sein Sohn
Michel Lemmel in Tetschen mussten Böhmen verlassen. Ersterer
ging
zurück nach Bamberg, letzterer ging nach Chemnitz.
2. In Bamberg gab es einen Streit zwischen dem Bischof und der
Bürgerschaft, der von Kaiser Siegmund, der gerade in Basel
weilte,
geschlichtet werden sollte. Bei der Verhandlung in Basel waren der
Fürstbischof und etliche Vertreter des Bamberger Rates
anwesend.
Letztere liessen ihren Unmut am Bischof in so handgreiflicher Weise
aus, dass es zu einer Messerstich-Verletzung des Bischofs kam, der in
seine Domburg nach Bamberg zurückfliehen musste. Unter den
gewalttätigen Bamberger Ratsherren in Basel aber war Hans Lemlein.
Der Schiedsspruch des Kaisers fiel nun gegen die Ratsherren aus; ihnen
wurde eine Geldbuße in der gewaltigen Höhe von 60ooo
Gulden
auferlegt. Hierdurch waren die führenden Bamberger Familien
genötigt, Bamberg zu verlassen. Aus der Bamberger
Lemlein-Familie
ging Martin Lemmel
1437 nach Chemnitz.

Porträt Hanns Lemlein, geb. um 1395, gest.1473.
Ratsherr in Bamberg; ab 1440 in Nürnberg, dort ab 1447
Ratsherr
und zeitweilig Bürgermeister. Wohlhabender Kaufmann mit Handel
im sächsischen Erzgebirge und in den Karpaten.
Sein Bruder Mertein ging 1437 nach Chemnitz, wo er der Stammvater
der meisten sächsischen Lemmel und Lämmel wurde.
[Schabkunstblatt von G. Fenitzer, wohl nach einem nicht erhaltenen
Ölbild. Privatbesitz.]
Da der Nürnberger Handel vorwiegend nach Osten orientiert war,
und
da Böhmen durch die Hussitenunruhen für den Handel
versperrt
war, zogen die Nürnberger Kaufleute nun über Hof,
Plauen,
Zwickau, Chemnitz (also etwa entlang der heutigen Autobahn) Richtung
Breslau, Krakau und darüber hinaus. In Breslau hatte
zeitweilig
der kaiserliche Schatzmeister Mathias
Lemmel gelebt, und in Krakau
lebte nun dessen Sohn, Sigismund
Lemmel, als Geistlicher und als
Komponist.
So lag es im Zuge der Zeit, dass die Familie Lemmel sich in
Chemnitz an der wichtigen Ost-West-Handelsstraße
niederließ.
5. Die Chemnitzer Lemmel:
Fernhändler, Tuchmacher,
Bergbau-Unternehmer
Aus den Chemnitzer Lemmel-Urkunden des 15. Jahrhunderts (9,10)
lässt sich folgendes sagen:
1427 lässt sich Michael
Lemmel, der zuvor in Freiberg als
Strauchdieb aus Tetschen aufgefallen war, in Chemnitz nieder. Er kehrt
jedoch nach Nürnberg zurück, und sein
älterer Bruder
Martin
übernimmt die Stellung und wird 1437 Bürger in
Chemnitz.
Vermutlich ist er in erster Linie ein Weber und Tuchhändler.
Er
muss recht wohlhabend sein, denn seine beiden Söhne kann er
auf
die Universität schicken. Der ältere, Martin, studiert
1431
in Wien und übernimmt dann das väterliche
Geschäft in
Chemnitz. Der andere, Michael,
studiert in Leipzig und Erfurt; er wird
Geistlicher und Jurist. Zwischen 1460 und 1480 sind drei Urkunden
erhalten, wonach er als kaiserlich approbierter Notar Streitigkeiten
der Klöster Chemnitz und Naumburg schlichtet.
Der jüngere Merten
Lemmel wohnt 1476 in der "Webergasse", die
sicher nicht nur so hieß sondern auch von Webern bewohnt
wurde.
Und seine Witwe besaß später (1495) ein Haus am
Salzmarkt,
das zuvor (1466) einem Viermeister der Tuchmacherzunft, Peter
Hösel, gehört hatte (6). Wie Helmut
Bräuer (11) zeigte,
zählten die Weber und Tuchmacher zu den angesehensten
Chemnitzer
Zünften. Aber die Lemmel gehörten nicht zu den
Familien, die
im Chemnitzer Rat saßen. Das waren die reichen Tuch- und
Metallhändler Schütz,
Neefe, Arnold, Thiel und einige andere.
Aber am Chemnitzer Salzmarkt und vor dem Niklastor, wo am Chemnitzfluss
Mühlen und Produktionsstätten lagen, waren die Lemmel
Nachbarn der Schütz, Neefe und Thiel. Vermutlich waren sie mit
diesen Familien auch verschwägert, aber die
spärlichen
Urkunden dieser Zeit berichten nichts über die Lemmel-Frauen
und
Lemmel-Töchter.
Um 1500 leben die schon zuvor erwähnten Brüder Hans und Paul
Lemmel in Chemnitz, von denen der eine vier, der andere
sechs
Söhne hat.
Paul ist vermutlich wieder ein Leinenweber. Er dürfte die
Tochter
seines Flachslieferanten aus Neukirchen geheiratet haben, denn alle 6
Söhne leben fortan auf dem Lande, in Neukirchen, Markersdorf
und
Adorf, wie man es in dem eingangs erwähnten Neukirchener
Gerichtsbuch dokumentiert findet.
Hans hingegen ging ins Erzgebirge, wo der Bergbau durch neue Funde und
verbesserte Techniken wieder attraktiv wurde. Seine Söhne sind
Bergbau-Unternehmer in den Bergstädten Schneeberg, Platten,
Annaberg, Geyer, Thum und Marienberg.
Hier haben wir wieder genau die Struktur eines Familien-Unternehmens,
wie wir es 100 Jahre früher von den Nürnberger und
Bamberger
Lemlein kennen gelernt hatten. Ähnlich hatten die Fugger und
Welser angefangen. Einer, Paul Lemmel, produziert Leinen und handelt
damit; sein Bruder Hans betätigt sich im Bergbau, der Onkel
Michael, Geistlicher und Jurist in Chemnitz, vermittelt das juristische
Rüstzeug und die Beziehungen zur Obrigkeit.
Möglicherweise gab es hier noch einen weiteren Lemmel,
über
den noch keine Urkunde aufgefunden wurde, und der Fernhändler
war:
In Dirschau (bei Danzig an der Weichselmündung) taucht wenig
später eine Lemmel-Familie auf, die vielleicht aus Chemnitz
kam.
Um 1500 war Friedrich von Wettin, der Sohn des sächsischen
Herzogs
Albrecht, Hochmeister des Deutschen Ordens, was dem Handel zwischen
Sachsen und dem alten Preußen sicher förderlich war.
Man
kann daher vermuten, dass auch die Dirschauer
Lemmel-Familie aus
Chemnitz stammte.
In den Lemmel-Generationen nach 1500, für die die nun vermehrt
einsetzenden Urkunden detaillierte Auskünfte geben, ist von
einem
größeren Lemmelschen Handelsunternehmen nichts mehr
festzustellen. Die Enkel und Urenkel sind Bauern, Handwerker und
Bergleute, die sich ganz ihrer neuen Umgebung eingegliedert haben.

Das alte Chemnitz.
In der Mitte das Rathaus und das um 1500 erbaute Gewandhaus,
dahinter in der Stadtmauer der Rote Turm.
Links hinter dem Rathaus die St.Jakobskirche, rechts oben
außerhalb der Stadtmauer das St.Georgs-Spital und die
St.Johanniskirche, links unten außerhalb der Stadtmauer die
St.Niklaskirche. Nach diesen vier Kirchenheiligen benannte Hans Lemmel
um 1480 seine vier Söhne.
Der Hausbesitz der Lemmel im 15. Jahrhundert lag in der Webergasse (im
Bild hinter dem Rathaus), am Salzmarkt (neben dem Gewandhaus), in der
Brudergasse bei der Abtei (im Bild im oberen linken Teil der Altstadt)
und "über die Brücke bei St.Niklas" (links vorne im
Bild).
Das "Kellerhaus", das Franz Lemmel 1698 kaufte, liegt unterhalb des
Schlosses (am oberen Bildrand zu sehen).
 Der Chemnitzer
Hauptmarkt [Titelbild von "Familie und Geschichte" Heft
Nr.36 2001]
Der Chemnitzer
Hauptmarkt [Titelbild von "Familie und Geschichte" Heft
Nr.36 2001]
6.1 Die Nachkommen des Chemnitzer Hans Lemmel:
Schneeberg
Der Chemnitzer Hans
Lemmel hatte vier Söhne, von denen drei in die
Bergstädte des Erzgebirges gingen. Von dem vierten, Nickel, ist
nur bekannt, dass er als jung verheirateter Mann starb.
Der eine Sohn, der wiederum Hans
hieß, wurde im Jahre 1512 mit
einem Bergwerk, einer "Fundgrube", in Schneeberg belehnt (12), wo er
Schöffe, Gemeinde-Vorsteher und Vorsteher der Knappschaft
wurde.
Nach anfänglichem Wohlstand scheint er aber in weiteren
Stollen,
mit denen er belehnt wurde, wenig Glück gehabt zu haben, denn
seine Witwe, die Hans
Lemlin, wird schließlich aus der
Kirchenkasse unterstützt.
Im Geiste von Reformation und Renaissance wurde in Schneeberg eine
Lateinschule gegründet, die um 1540 von neun jungen Lemmeln
besucht wurde. Acht der Schneeberger Lemmel besuchten eine
Universität. Zwei von ihnen wurden protestantische Pfarrer und
Schulrektoren. Einer wurde Apotheker und ging nach Lüneburg,
wo er
aber leider "in grosser Melancholie" und kinderlos starb.
1 2
2 3
3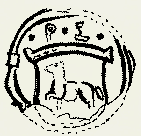
1: Eigenhändige
Unterschrift
des Apothekers
Andreas Lemmel
in Lüneburg
1580.
2:
Eigenhändige Unterschrift
des Magisters Petrus Lemmel in Schneeberg
1614,
3:
die Nachzeichnung
seines Siegels.
Zwei Schneeberger Lemmel-Brüder gingen um 1550 als Kaufleute
nach
Wien (13) in die Hauptstadt des Reiches. Der eine, wieder ein Hans
Lemmel, wurde dort ein wohlhabender Kaufmann. Da seine
Frau eine
Wienerin war, wurde er sogar in den Stadtrat gewählt. Er hatte
die
Schwester des Wiener Universitätsrektors, eine Pirkheimerin
geheiratet, eine Verwandte des berühmten Nürnberger
Humanisten Willibald
Pirkheimer. Der Bruder, Stefan Lemmel,
handelte
mit Wein aus Sizilien. Beide waren führende Protestanten in
Wien,
und als dort der Habsburger-Kaiser Rudolf der II. die Gegenreformation
betrieb, musste die Familie Wien
verlassen. Bei der Suche, wohin die protestantischen Wiener Lemmel
flüchteten, habe
ich bisher nur eine Nachkommen-Linie in der Oberpfalz entdeckt, von der
wiederum eine Lemmel-Linie abstammt, die wieder katholisch wurde und
später als "Ritter
Lemmel
von Seedorf" geadelt wurde.
Zurück nach Schneeberg. Der Wohlstand wurde im Bergbau durch
harte
Arbeit erworben. Wenn in einer Urkunde das Wort "Bergmann" steht, so
kann das zweierlei bedeuten: Es kann ein reicher Herr sein, der die
Bergarbeiter bezahlt und das Erz verkauft; es kann aber auch ein
Arbeiter sein, der selbst ins Bergwerk hinabsteigt und harte
Muskelarbeit verrichtet. Die Schneeberger Lemmel waren beides, wie aus
einigen Urkunden zu ersehen ist. Offenbar schickte der Bergunternehmer
seine Söhne bereits im Alter von 12 Jahren als Arbeiter ins
Bergwerk hinunter, damit sie den Betrieb von Grund auf erlernten.
Eines der Schneeberger Bergwerke hieß "der Rappolt"; es war
um
1490 von dem Nürnberger Handelsherrn Friedrich Rappold
(14)
angelegt worden. Seine Tiefe wird in "Lachter" (etwa 1,90 Meter)
gemessen. In einer Chronik des Schneeberger Geschichtsschreibers Peter
Albinus heißt es:
1526 ist Jacob Lemmel,
itziger
Berggeschworener in Schneeberg, damals
ungefehr 12 Jahre alt, ins
tiefste uffm
Rappolt, in die 34 Lachter tief
gefallen, und bey 3/4 Stunden
gelegen. Sind
seine Gesellen ausgefahren und
sich verkrochen. Ist ihm doch
in solchem
hohen Falle nichts widerfahren, als
daß er an dem
linken Ohr
übelhörendt worden.
Später wurde dieser "übelhörende" Jakob
Lemmel
Knappschafts-Vorsteher und Berggeschworener.
Es waren sehr harte Zeiten. Zweimal gab es in Schneeberg
Stadtbrände, in denen auch das Lemmel-Haus abbrannte. Mehrmals
gab
es Pest-Epidemien. Aus dem Jahre 1521 ist ein merkwürdiger
Bericht
überkommen. In einer Chronik (15) heisst es:
Von denkwürdiger
Gottlosigkeit und
Frevelthat einiger rohen und losen
Pursche: Anno 1521 rumorte
die Pest in
Schneeberg also, daß etliche 100
daran auffgerieben wurden. In
der Pest-Zeit
fanden sich einige gute Schmauß-
Brüder in Hannß Lemmels
Haus
zusammen, waren lustig und guter Dinge, trieben
also ohne Furcht der Seuche
Tag und Nacht,
haben die ganze Sterbens-Zeit
über gefressen und
gesoffen, lustig und
guter Dinge gewesen, und diese alle
sind gleichwohl von der
Seuche unangetastet
und lebendig geblieben. - So
steht es in einer
Schneeberger Chronik unter
der Überschrift: "Von Gottes
Wunder-Gerichten bey
Sterbensläufften".
Während hier Hans Lemmel die Pest erfolgreich mit Alkohol
bekämpfte, wurde später dieser Familienzweig durch
die Pest
ausgelöscht. Nur bei dem nach Wien abgewanderten Zweig gibt es
heute lebende Nachkommen.
Von dem Wiener Ratsherrn Hans
Lemmel, der 1531 in Schneeberg (13)
geboren wurde, seinem Vetter Andreas
Lemmel, dem Lüneburger
Apotheker, und seinem Neffen Petrus
Lemmel, der Magister und Konrektor
der Schneeberger Lateinschule war, gibt es eigenhändige
Schriftstücke, die teils sogar mit ihrem Siegel (16) versehen
sind. Die Siegel zeigen jeweils ein Lamm-Wappen, das aber nur entfernt
an das bekannte Lamm-Wappen der Bamberger Vorfahren erinnert.
Ein besonderes Prunkstück der Familiengeschichte ist die
Porträtmedaille (17) des Wiener Ratsherrn Hans Lemmel von
1583.
Sie zeigt auf der einen Seite Hans Lemmel im Profil, auf der
Rückseite seine Frau Ursula
Lemlin geborene Pirkheimer.
Ein
anderes Exemplar zeigt auf der Rückseite Hans Lemmels Mutter,
die
Schneebergerin Margaretha
Lemlin. Ihr Geburtsname ist leider nicht
überliefert, so dass man nicht weiß, aus welcher
Schneeberger Familie die Margaretha stammt, deren Porträt im
Wiener Münzkabinett zu besichtigen ist. (Erst 2011 stellte
sich heraus, dass ihr Geburtsname Preyßker
war und dass sie nicht die Mutter sondern die Stiefmutter des Wiener
Hans Lemmel war.)

Hans Lemmel, geboren 1531 in Schneeberg im
sächsischen
Erzgebirge,
Kaufmann, Ratsherr und protestantischer Kirchvater in Wien,
gestorben 1601.
Porträtmedaillen im Münzkabinett des
Kunsthistorischen
Museums Wien.
Oben: Porträt Hans Lemmel und sein Siegel.
Unten: seine Mutter Margaretha Lemlin in Schneeberg und seine Frau
Ursula
Lemlin geborene Pirkheimer in Wien.
Mitte: Die Beschriftung auf seinem Testament.
6.2 Die Nachkommen des Chemnitzer Hans
Lemmel: Marienberg
Ein anderer Sohn des Chemnitzer Hans Lemmel war Jakob Lemmel,
der erst
kürzlich von Klaus Schröpel in Thalheim in einem
alten
Bergbuch (18) entdeckt wurde. Er ging als Bergunternehmer nach
Marienberg (19), wo er zahlreiche Nachkommen hatte. In den
Kirchenbüchern, die hier schon um 1550 beginnen, sind bereits
10
Lemmel-Vettern verzeichnet, die in kurzer Zeit 41 Kinder taufen
ließen.
Aber die Bergwerke waren nun nicht mehr so ertragreich, und um 1600
sind alle Lemmel wieder aus Marienberg verschwunden. Etliche raffte die
Pest dahin, aber einige sind abgewandert, und wir finden sie an anderen
Orten wieder: als Schneider in Schwarzenberg oder als Zuckersieder in
Leipzig. Aber dort fielen ihre Familien freilich auch bald der Pest
oder dem 30-jährigen Krieg zum Opfer, so dass es aus dem einst
so
zahlreichen Marienberger Lemmel-Stamm schon bald keine Nachkommen mehr
gab.

Eine Urkunde von 1532: Jakob Lemmel erhält vom Bergmeister
eine Fundgrube in Geyer verliehen.
Melchior Lemmel
aus dem Marienberger Stamm wurde Bürgermeister von
Glauchau. Drei seiner Enkel gingen um 1680 mit einer
holländischen
Gesellschaft als Pulvermacher nach Niederländisch-Ostindien,
dem
heutigen Indonesien. Dort starben sie an Tropenkrankheiten, wodurch
dieser Familienzweig ausgelöscht wurde. Hierüber
berichtete
ich schon am Dresdener Familientag (1).
Schließlich aber gingen zwei Bergbau-Lemmel aus dem
Erzgebirge
nach Norwegen (20). Die Erschließung des norwegischen
Bergbaus
erfolgte mit der tatkräftigen Hilfe von Bergleuten aus dem
Erzgebirge. Im Jahre 1540 wurde eine "Norwegische Bergwerksordnung" in
Zwickau in deutscher Sprache gedruckt. Zu dieser Zeit reformierten die
sächsischen Kurfürsten Moritz und August ihre
Bergverwaltung;
1554 wurde eine kursächsische Bergordnung erlassen (20a).
In Trondheim in Norwegen lebte noch um 1770 eine Lehrer-Familie Lemmel.
Im Jahre 1659 tauchte in Schneeberg ein Mathias Lemmel auf,
"ein
Bergmann gebürtig aus Norwegen", dessen Nachkommen in Freiberg
und
Halsbrücke als Hüttenmeister, Berggesell, oder
Drahtzieher
lebten.

Ein Holzschnitt von etwa 1528, der ein Edelmetallbergwerk
im
sächsischen Erzgebirge zeigt. (20b)
6.3 Die Nachkommen des Chemnitzer Hans Lemmel:
Annaberg
Georg, der
dritte Sohn des Chemnitzer Hans Lemmel (10), ging ebenfalls
als Bergunternehmer ins Erzgebirge, und zwar zunächst nach
Platten
auf der böhmischen Seite.
Hier in den Bergstädten herrschten rauhe Sitten, wie aus
folgendem
Ereignis zu ersehen ist:
Anno 1586 in Joachimsthal im Erzgebirge ist der
Müller
Matthes Engelmann
erstochen worden von Georg
Lemmel zu Weynachten. Anno 1587 wurde
zu
dreyenmalen öffentlich Halsgericht gehalten
über Georg
Lemmeln dem
flüchtigen Mörder.
Er wurde aber nicht gefunden. Vermutlich floh er nach
Ehrenfriedersdorf, wo zwei seiner Söhne lebten. Für
den
einen, der wiederum Georg
Lemmel hieß, ist eine Kuriosität
zu vermelden: Er war von Beruf ein Fleischer und heiratete die Tochter
eines anderen Fleischers, der "Petersillig" hieß; das war
wohl
ein Spitzname, der daher rührte, dass er die Wurst mit viel
Petersilie versetzte. Georg Lemmel übernahm nun die
Fleischerei
seines Schwiegervaters und übernahm damit auch dessen Namen.
Als
er starb, wurde im Totenbuch eingetragen: "Yörg Petersillig sonst
Lämmel, Bürger und Fleischer in
Ehrenfriedersdorf". Sein Sohn
und seine Enkel hießen dann gar nicht mehr Lämmel
sondern
nur noch Petersillig.
Der Mörder Georg Lemmel war einer der Enkel des ersten Georg
Lemmel aus Chemnitz. Dieser war also gut beraten, als er sich schon
bald aus dem gefährlichen Bergbau zurückzog. Er ging
erst
nach Annaberg, wo sein ältester Sohn 1534 heiratete; dann
erwarb
er in der Nähe Landbesitz, wo die zahlreichen Nachkommen als
Bauern lebten.
Georgs Sohn Bartel Lemmel
erwarb um 1590 ein Bauerngut in Gelenau.
Unter seinen Nachkommen finden wir sowohl Klaus Lämmel,
den
Organisator des Chemnitzer Familientages, als auch Thomas Lämmel,
unseren Gastgeber in Lichtenwalde.
Einer von Georgs Enkeln, Peter
Lemmel, erwarb ein Bauerngut in Drebach.
Er ist dort als ein "Pferdner" verzeichnet: das ist der Besitzer eines
größeren Bauerngutes, der Pferde besass, im
Gegensatz zu den
Kleinbauern, die nur Ochsen hatten. Im 16. Jahrhundert gab es
Bauernaufstände gegen die zu hohen Steuern, die von der
Obrigkeit
verlangt wurden. Dabei war in Drebach Peter Lemmel der erste von vier
Sprechern der Bauern. Es ist wohl seinem Geschick zu verdanken, dass
für die Aufrührer in Drebach alles gnädig
ausging,
während an anderen Orten mit Einkerkern und Hängen
gestraft
wurde. Mit den Drebacher Bauern wurde 1590 ein Vertrag geschlossen, der
ihnen mehr Rechte als seither zugestand.
Ein anderer von Georgs Enkeln, Caspar
Lemmel, lebte um 1600 in der
Bergstadt Thum. Man könnte vermuten, dass er auch hier als ein
Bergwerks-Unternehmer lebte, aber das trifft nicht zu; er hatte
umgesattelt. Es ist eine Beschreibung seines Besitzes erhalten (21).
Sein Besitz, Chemnitzer Strasse 3, war ein "Bürgerhaus mit
Braubrechtigung"; zu seinem Haus gehörten "Hof und Garten,
Äcker und Wiesen". Das Haus hatte "sehr alte gewölbte
Keller,
in denen die Waren eines Frachtfuhrmannes und die Bierfässer
eines
brauberechtigten Bürgers gelagert werden konnten". Daneben gab
es
einen geräumigen Pferdestall.
Caspar Lemmel war also ein Landfuhrmann, der seine Pferde auf seinen
eigenen Wiesen weiden lassen konnte. Welche Waren er in seinem Keller
lagerte und mit seinen Frachtwagen transportierte, ist nicht
überliefert. Er dürfte mit allem gehandelt haben, was
zur
Versorgung der Bergarbeiter mit Kleidung und Nahrung nötig
war.
Wie Helmut Bräuer zeigte (11), waren die Bergstädte
auf
Zulieferungen in so hohem Maße angewiesen, dass
beispielsweise
von Chemnitz nach Annaberg wöchentlich 18 Wagenladungen Brot
geliefert wurden. So konnte Caspar Lemmel hier als Landfuhrmann ein
gutes Geschäft machen.
Georg Lemmel aus Chemnitz wurde der Stammvater der
Lemmel/Lämmel-Stämme Cranzahl, Buchholz, Auerbach,
Jahnsbach,
Gelenau, Drebach, Venusberg, Neundorf, Gestewitz, u.a.
In allen diesen Orten gehören die Lemmel zu den
ältesten
ansässigen Familien. Manche Bauernhöfe hier waren 300
oder
400 Jahre lang in Lemmel-Besitz, so dass man den Namen Lämmel
jetzt auch auf Landkarten finden kann: Oberhalb von Drebach gibt es den
627 Meter hohen "Lämelberg", der als ein beliebtes
Ausflugsziel
gilt.
Auch in Neudorf und Cranzahl gibt es Flurnamen wie
Lämmel-Bächlein, Lämmel-Mühle,
Lämmel-Kalkofen, die bereits im 16. Jahrhundert beurkundet
sind.
Einige der Lämmel-Höfe waren mit dem
dörflichen
Richteramt verbunden, das ein erbliches Amt war.
Auf einem Bauerngut in Cranzahl lebte der Schöffe und Richter
Michel Lemmel,
der aus vier Ehen 16 Kinder bekam. Über seine
dritte Frau steht 1619 im Kirchenbuch: Christina Lemmel,
Hausfrau des
Gerichtsschöppen Michel Lemmel, wurde am 9. Juli "nachmittags
2
Uhr vom Donner im Hause getroffen und blieb tot liegen".
In Buchholz bei Annaberg entwickelte sich ein Zentrum des
Posamenten-Gewerbes, um den in der Barockzeit aufkommenden Bedarf an
Borten, Fransen, Quasten und anderen Verzierungen für
Militäruniformen, Trachten und Polstermöbel zu
decken. Da gab
es im Buchholzer Lämmel-Stamm eine Dynastie von 14
Posamentier-Meistern. Unter den Nachkommen gibt es einige
künstlerische Begabungen, darunter den Dresdener Graveur Hermann
Lämmel, der 1892, zur 400-Jahrfeier der
Entdeckung Amerikas, eine
Gedenkmedaille entwarf und prägte (22).
Nur nebenbei ist der eine oder andere noch mit dem Bergbau verbunden.
1623 heiratet in Zwönitz der Bäckermeister Martin Lemmel.
Bald darauf wird er im Bergbuch des Bergamtes Geyer (23) als "Gewerke
mit einem Kux" verzeichnet. Sein Neffe Christof Lemmel, der
als
Müller in Zwönitz lebt, ist als "Gewerke mit einem
halben
Kux" verzeichnet. Diese beiden sind nicht aktive Bergleute; sie haben
mit ihren "Kuxen", das entspricht etwa heutigen "Aktien", Anteile am
Bergwerk erworben und hoffen nun auf einen guten Ertrag. Aber das
Bergglück war dem Martin Lemmel nicht gewogen, und er starb in
bitterer Armut. Am 11. März 1660 wurden in Zwönitz
zwei alte
"verlebte" Eheleute Martin Lemmel und sein Weib Catharina zusammen in
einem Grab "verscharret", nachdem sie nur 12 Stunden nach einander
gestorben waren. So steht es in der Lehmannschen Chronik (15) "derer
natürlichen Merkwürdigkeiten" im Erzgebirge.
Mitten in Zwönitz gibt es gleich neben dem Rathaus ein
ansehnliches Gebäude, das als das "Lämmelhaus"
bekannt ist.
Ich hatte vermutet, dass dies das Anwesen des Martin Lemmel des
17.Jahrhunderts gewesen sein könnte, aber das war es nicht. Horst
Lämmel in Thalheim erkundete, dass das
Lämmel-Haus
ursprünglich die Zwönitzer Posthalterei gewesen war,
die erst
um 1920 von dem Spediteur Oswald
Lämmel aus dem Drebacher
Lämmel-Stamm übernommen wurde. Erst seit dieser Zeit
heisst
es das "Lämmel-Haus".

Das "Lämmel-Haus" (Mitte) in Zwönitz am
Markt.
Es ist die ehemalige Posthalterei gleich neben dem Rathaus (rechts).


Neukirchen bei Chemnitz: Ausschnitte aus der Türkensteuerliste
1501.
Oben: "Pauel Lemmell". Darunter der "Hausgenosse" "Jorge Lemmell".
7. Die Nachkommen des Chemnitzer Paul Lemmel
Man hat sich gewundert, dass Paul
Lemmel, der einer durch und durch
städtischen Familie angehörte, mit seinen
Söhnen ins
Dorf zog (10). Einer der Nachkommen, der Pfarrer und Familienforscher Lothar Wunderwald,
formulierte es so: "Warum soll ein Großkaufmann Paul Lemmel
sich
plötzlich hinter den Pflug stellen, den Kuhstall ausmisten und
ein
kümmerliches Leben unter Menschen führen, die kaum
lesen und
schreiben konnten?" Nun, ganz so kümmerlich dürfte
das
Dorfleben doch nicht gewesen sein.
Es gab gute Gründe für den städtischen
Unternehmer, vor
die Tore der Stadt zu ziehen. Wie Helmut Bräuer es schilderte
(11), waren die Leineweber in der Stadt recht beengt. Sie brauchten
Platz zum Lagern von Flachs und zum Aufstellen der Webstühle;
sie
benötigten freie Wiesenflächen zum Bleichen des
Leinens;
schließlich mussten sie Pferde und Fuhrwerke irgendwo
einstellen.
Auch gab es in Chemnitz mehrfach Streit um Privilegien und Kontroversen
mit den Zünften und dem Stadtrat, so dass auf dem Lande
"unzünftige" Webstühle aufgestellt wurden, auf denen,
wie man
es heute nennen würde, Schwarzarbeit gemacht wurde.
Als Paul Lemmel
um 1500 nach Adorf und Neukirchen hinauszog, war er
über 50 Jahre alt, und seine sechs Söhne kamen gerade
ins
beste Heiratsalter. So verwundert es nicht, dass sie am neuen Wohnort
in die bäuerliche Bevölkerung einheirateten. Wie sie
hier
lebten, ist zwei Generationen später beurkundet.

Ausschnitt aus dem Gerichtsbuch von Ehrenfriedersdorf von 1571.
"Nickel Lemmels hinderlaßene Erben und ihre Stifmutter" lassen
das Ergebnis ihrer Erbverhandlung beurkunden.
1571 starb in Thum Nickel
Lemmel, einer von Pauls Enkeln. In seiner
Hinterlassenschaft fanden sich 36 Ellen "Flachsen Linnet", 3
Kühe
und verschiedener Kleinkram, darunter ein flachsenes Tischtuch, ein
"grobes Bettzeug nit gar neu", ein Mantel, eine Truhe, eine
Zinnschüssel, und sonst nichts nennenswertes. Er hatte also
eine
kleine Landwirtschaft für den Eigenbedarf, sowie einen
bescheidenen Handel mit Leinen. Wohlhabend war er nicht, denn er
hinterließ auch Schulden. Sein Vater, Nickel Lemmel in
Adorf, war
noch wesentlich wohlhabender gewesen, mit einem
größeren
Bauerngut für den Flachsanbau und mit einer Gastwirtschaft.
Etliche von Pauls Nachkommen sind in den Steuerverzeichnissen als
"Gärtner" eingetragen. Das darf man nicht als Gärtner
im
heutigen Sinne verstehen. Es zeigt nur an, dass sie nicht wie ein Bauer
ein Bauerngut zu versteuern hatten, sondern dass ihr Landbesitz nur aus
einem kleineren Garten bestand. Man muss annehmen, dass sie ein
Handwerk ausübten, vielleicht das eines Leinenwebers. Erst in
den
späteren Kirchenbucheintragungen sind die ausgeübten
Handwerke explizit angegeben.
In Neustadt bei Chemnitz zeigt sich, dass sich hinter der Bezeichnung
"Gärtner", wie es in der Steuerliste steht, ein
"Mälzer",
also Malzhändler, verbarg, der durchaus wohlhabend gewesen
sein
mag. Einer von ihnen, Hans
Lemmel, 1644 in Neustadt als Sohn eines
"Mälzers" geboren, ist der sächsisch-polnische
General-Kriegszahlmeister Johann
Lämmel unter August dem Starken,
über den ich am letzten Familientag in Dresden berichtete (1).
1692 stiftete er der Chemnitzer Nikolai-Kirche eine Glocke, die 225
Jahre lang den dortigen Lemmeln läutete, bis sie 1917 im
Ersten
Weltkrieg eingeschmolzen werden musste.
Sein Bruder Franz Lemmel,
der zunächst, wie sein Vater, als
Mälzer und Gerichtsschöffe in Neustadt lebte, scheint
dort
ein gutes Geschäft gemacht zu haben, denn 1698 kaufte er sich
in
Chemnitz eine bekannte Bierwirtschaft, das sogenannte Kellerhaus unter
dem Schloss, das derzeit gerade renoviert wird. Die Chemnitzer
Zeitungen berichteten darüber (siehe Abbildung). Seine
Söhne
blieben hier aber nicht sondern zogen das bäuerliche Leben in
Stelzendorf vor. So blieb das Kellerhaus leider nicht in der Familie.

Unter den Ururenkeln des Chemnitzer Paul Lemmel sind fünf, die
wiederum Paul Lemmel
heißen, und einer davon ist das schwarze
Schaf der Familie. Während alle braven Lemmel im Neukirchener
Kirchenbuch verzeichnet sind, finden sich über diesen Paul
Lemmel
unrühmliche Einträge im Verzeichnis der "Huren und
Buben im
Kirchspiel Neukirchen" und im "Malefizbüchlein der
Gutsherrschaft
Neukirchen". Soll ich hieraus etwas berichten? Ja?
Also: Zu dieser Zeit saß auf dem Neukirchener Rittergut ein
übler Herr namens Heinrich
Gröbel, und besagter Paul Lemmel
gehörte zu seinem Gesinde. Im Jahre 1609 beginnt die
Geschichte
damit, dass "Paul Lemmell
zu Neukirch hinweggangen ist, weil er eine
Zeitlang mit Katharina R. hurerey getrieben und sie geschwengert welche
gleichfalls auch davongelauffen". Zwei Jahre später wird Paul
Lemmel vom
Pfarrer wieder "zu seinem Pfarrkind angenommen", nachdem er seinen
Ehebruch "öffentlich bekannte und auch öffentlich
Buße
tun mußte". Auf dem Gut wird er von Heinrich Gröbel
wieder
angenommen, muss aber einen "Revers geben, dass er niemals
erzähle, worüber er gesündiget hat". Aus
Dank für
die Wiederaufnahme beim Schlossherrn Gröbel übernahm
er die
Durchführung einer nächtlichen Beerdigung des an der
Pest
verstorbenen Sohnes Jochim des Schlossherrn. Derweil wurde
Gröbels
Tochter Sibille diskret nach Böhmen geschickt und der, der sie
geschwängert hatte (zum Glück war es nicht unser Paul
Lemmel), wurde erschossen. Darauf aber wurde Heinrich Gröbel
in
der Augustusburg in Haft genommen, und das Gut Neukirchen wurde an den
Kurfürsten abgetreten. Der Pfarrer schrieb dazu: "Gott say
Lob,
Ehr und Dank, dass dieser Tyrann und gröbste Bauer hinweg
ist."
Gleichzeitig verschwand auch Paul Lemmel.
Aber alle anderen Nachkommen des Chemnitzer Paul Lemmel waren
ehrenwerte Leute. Unter denen, die die verschiedensten
ländlichen
Berufe ausübten, gab es auch wieder einige Bergarbeiter. Und
wenn
man darüber Berichte findet, dann stößt man
wieder
einmal auf ein Unglück: ein Beispiel für die
schrecklichen
Arbeitsbedingungen im damaligen Bergbau.
Dazu muss ich zunächst einige Erläuterungen geben. In
Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge gab es ein Bergwerk mit einem Schacht,
der der "Junge Bierkrug" genannt wurde, etwa 50 "Lachter" tief, das
sind etwa 80 Meter. Die Bergleute, die zum Schutz einen "Schachthut"
auf dem Kopf hatten, fuhren "von tag", (also "hinunter"), über
eine "Fahrt", das ist ein System von beweglichen Leitern, die, von
einem Mühlrad angetrieben, ständig auf und ab bewegt
wurden.
Im Totenbuch des Jahres 1737 findet man diesen Eintrag:
Johann Christoph Keller,
juvenis Metallicus, 20 1/4
Jahre alt, und Johann
Christoph Lämmel,
Bergknab, 14 1/4 Jahre alt. Beide sind
Sonnabend den
29. Juni früh 3/4 5 Uhr aufn jungen
Bierkrug nach verrichteten Gebet
eingefahren, an
ihre Arbeit zu gehen; nachdem aber dieser
nomine Lämmel kaum 1 1/2
Lachter von tag
gefahren, so fället Er, ohne daß es jemand gewahr
wird, von der Fahrt, Gott
weiß, wie es
zugegangen, hinweg, und da noch zwey purschen in der
mitten eingefahren, berührt er
diese nicht, den
untersten aber, nomine Kellern, nimmt er mit
hinein, daß sie beiderseits so
elendiglich
umbkommen müssen, da Lämmel in die 48 Lachter,
Keller aber 35 Lachter gefallen. Keller
ist
dergestalt elendiglich zugerichtet gewesen, daß sein
Gehirn im Schachthut zusammengelesen
werden
mußte, beyde sind aber tod herausgezogen und
nach Hause gebracht worden zum
größten
Leidwesen ihrer Eltern.
Im Gegensatz zu diesen Bergleuten lebten die meisten Nachkommen des
Paul Lemmel ein ruhiges ländliches Leben ohne
spektakuläre
Ereignisse, viele von ihnen als Leineweber und Strumpfwirker. Auf dem
Lande hatte die Pest nicht so schreckliche Auswirkungen wie in den
Bergstädten, so dass sich die ländlichen Lemmel
stärker
vermehrten als die in Schneeberg und Marienberg, die fast ganz der Pest
zum Opfer fielen.
Für den Familienforscher gibt es hier das Problem, dass zu
viele
Lemmel den selben Vornamen haben. Den extremsten Fall gab es um 1590 im
Kirchspiel Neukirchen: Hier und in den Nachbarorten Neustadt und
Jahnsdorf gab es gleichzeitig acht Männer namens Paul Lemmel, die
alle nach ihrem Urgroßvater, dem ersten Chemnitzer Paul
Lemmel
benannt worden waren. Da in den vorhandenen Urkunden die verschiedenen
gleichnamigen Vettern nicht immer klar unterschieden werden
können, so gibt es in manchen Ahnentafeln Unklarheiten,
welcher
Paul Lemmel der richtige Vorfahr ist. Und das, obgleich aus diesem
Familienzweig die bedeutenden Familienforscher Herbert E. Lemmel
und
Johannes E. Herold
stammen.
Die Nachkommen des Paul Lemmel lebten hauptsächlich in
Neukirchen,
Klaffenbach, Stelzendorf, Leukersdorf, Neustadt, Markersdorf,
Jahnsdorf, Gornsdorf, Auerbach, Adorf, Raschau, Chemnitz-Borna,
Rödlitz, Eschefeld.
Zum Eschefelder Lämmel-Stamm gehört der Leipziger
Kupferstecher Moritz
Lämmel, dessen Porträt-Stahlstiche
berühmter Leute wie Beethoven, Goethe (24),
Hölderlin,
Schopenhauer, Schumann um 1860 weite Verbreitung fanden und im
Brockhaus-Lexikon verwendet wurden. Von seinem Sohn Martin, der
Kunstmaler war, sind Entwürfe für Spielkarten
bekannt.
8. Die Chemnitzer Lämmel nach 1800
Nachdem die Nachkommen der ersten Chemnitzer Lemmel kurz nach 1500 auf
das Land und ins Erzgebirge gezogen waren, gab es in der Stadt Chemnitz
lange Zeit nur vereinzelte Lemmel. Erst mit der Industrialisierung im
19. Jahrhundert zogen viele Lemmel und Lämmel aus dem
Erzgebirge
zurück nach Chemnitz, die meisten als Arbeiter und Handwerker.
Die
Schreibweise des Namens ist jetzt vorwiegend Lämmel.
Einige brachten es hier zu Ansehen und Wohlstand.
Der Strumpfwirker Benjamin
Lämmel, geboren 1784 in Neukirchen,
heiratete 1814 in Chemnitz-Nikolai (mit dem Geläut der vom
General-Kriegszahlmeister Johann Lämmel gestifteten
Lemmel-Glocke). Sein Sohn gründete in
Chemnitz-Schönau eine
Trikotagenfabrik. Dessen Enkel Max
Lämmel, Trikotagenfabrikant
und Kirchenvorsteher, stiftete der Chemnitzer Lutherkirche
Abendmahlskelch, Kanne und Leuchter (25), zum Gedenken an seine im
ersten Weltkrieg gefallenen Söhne.
Damals gab es in der Lutherkirche bereits eine andere Lemmel-Stiftung.
Alexander Lemmel,
geboren 1839 in Neukirchen, brachte es als
Bäcker in Chemnitz zu Wohlstand. Er stiftete das Taufbecken in
der Lutherkirche.
1986 war es der Ingenieur Roland
Lämmel, wieder aus einem anderen
Lämmel-Stamm, der mir als Mitglied des Kirchenvorstandes der
Lutherkirche über diese Stiftungen berichtete.
Unter den Lemmeln aus Neukirchen und Klaffenbach gab es mehrere
Firmengründer. Arthur
Lemmel (*1880) gründete ein
Textilwarengeschäft in Leipzig. Karl Hermann Lemmel
(*1834)
gründete eine Handschuhfabrik in Limbach, die unter seinem
Sohn
Theodor Max Lemmel
bis in die 1960er Jahre als Stickerei-Manufaktur
fortbestand. Paul Lemmel
(*1867), Sohn des Chemnitzer Bäckers
Alexander Lemmel, ging als Kaufmann erst nach Tanger in Marokko, dann
nach Barcelona in Spanien, wo sein Enkel noch heute eine Handelsfirma
für chemische und pharmazeutische Produkte betreibt. Und noch
in
jüngster Vergangenheit gründete Stefan Lämmel
ein
Autohaus, mit dem er von Chemnitz nach Neukirchen hinauszog.

Literatur
1 Hans-Dietrich Lemmel: Die Familie
Lemmel und August
der Starke. In: Familienforschung in
Mitteldeutschland 39. Jg. 1997/1998
S.193-204.
Erweiterte Fassung in: "lemlein filii" Heft 5 (1999)
S.24-40, Selbstverlag Höfler-Lemmel D-92318 Neumarkt, Parkstr.
6.
2 Hans-Dietrich Lemmel:
Nürnberger
Lemlein im 14. Jh.; Fernhändler und Montanunternehmer bereits
um
1300? In: Blätter für deutsche Landesgeschichte
Bd.120 (1984)
S.329-370. Und in: "lemlein filii" Heft 4 (1991), Selbstverlag
Höfler-Lemmel D-92318 Neumarkt, Parkstr. 6.
3 Hans-Dietrich Lemmel: Regesten und
Stammfolgen
aller Lemmel und Lämmel, Hektografien in der Deutschen
Zentralstelle für Genealogie in Leipzig; und: Mikrofilme Nr.
1691488 bis 1691491 (1990) der Genealogischen Gesellschaft von Utah.
4 Julius Theodor Pinther:
Chronik der Stadt
Chemnitz und Umgegend, Chemnitz 1855, S.185.
5 Im Rahmen dieser
Übersicht über
die Lemmel-Geschichte ist es unmöglich, die genauen
Quel-len-angaben für die vielen benutzten Auszüge aus
Kirchen- und Gerichtsbüchern im einzelnen anzugeben.
6 Herbert E. Lemmel: Herkunft
und Schicksal
der Bamberger Lemmel des 15. Jh.; in: 101. Bericht des Historischen
Vereins Bamberg, Bamberg (1965), S.13-220.
7 Hans-Dietrich Lemmel: Die
Bamberger Lemmel
in Böhmen und Ungarn 1364-1475. In: "lemlein filii" Heft 2
(1975)
S.37-78, Selbstverlag Höfler-Lemmel D-92318 Neumarkt, Parkstr.
6.
8 Hans-Dietrich Lemmel:
Regesten und
Stammfolgen der Nürnberger und Bamberger Lemlein, Manuskripte
in
Arbeit. Vorläufige Fassung in Nürnberger Archiven
hinterlegt.
9 Herbert E. Lemmel:
Geschichte der
erzgebirgisch-vogtländischen Lemmel im 15.-16. Jahr-hundert;
in:
Deutsches Familienarchiv Bd.43 (1970) S.235-348.
10 Hans-Dietrich Lemmel: Regesten und
Stammfolge der
Familie Lemmel in Chemnitz 1427-1526, sowie 1501-1564 in Adorf und
Neukirchen bei Chemnitz, 1556-1671 in Neudorf bei Annaberg, u.a.
Lemmel-Verlag, A-1170 Wien, Handlirschgasse 14.
11 Helmut Bräuer: Handwerk im
alten Chemnitz.
Chemnitz, 1992. - Helmut Bräuer: Chemnitz und das Erzgebirge
um
1500; Vortrag am Lemmel/Lämmel-Familientag
Chemnitz-Lichtenwalde
2000.
12 Hans-Dietrich Lemmel: Regesten und
Stammfolgen
der Bergunternehmerfamilie Lemmel in Schneeberg im Erzgebirge
1512-1624. Lemmel-Verlag, A-1170 Wien, Handlirschgasse 14.
13 Hans-Dietrich Lemmel und Gerhard
Lemmel: Hans
Lemmel in Wien; Handelsmann, Ratsherr, Protestant. In: Wiener
Geschichtsblätter, 35. Jg. 1980 S.69-81.
14 Der Nürnberger Handelsherr
Friedrich Rappold
ist ein Vorfahr von Konrektor Eugen Schöler in Schwabach, der
auf
dem Familientag 1989 in Nürnberg-Rummelsberg ein Referat
über
Nürnberger Familienwappen gehalten hatte. - Petrus Albinus:
Meissnische Bergchronik Anno 1590. Zitiert bei Gustav Sommerfeldt:
Erzgebirgische Forschungen und Geschlechterkunde Teil 1, Dresden 1929.
Jetzt auch: Reprint-Ausgabe Verlag v.Elterlein, Stuttgart.
15 Christian Lehmann: Historischer
Schauplatz derer
natürlichen Merckwürdigkeiten in dem
Meißnischen
Ober-Ertzgebirge, Leipzig 1699, S.993. Und Christian Meltzer: Historia
Schneebergensis Renovata, Schneeberg 1716, S.1059. Beides jetzt auch:
Reprint-Ausgaben Verlag v.Elterlein, Stuttgart.
16 Hans Lemmels Siegel 1592: Archiv des
Schottenstiftes Wien, Stiftungsurkunde vom 12.6.1592. Verg. Quellen zur
Geschichte der Stadt Wien, Bd.I/3 S.102 Urk. Nr.2702; Bd.I/5 S.153
Nr.5599. - Petrus Lemmels Siegel 1614: Staatsarchiv Dresden,
Gerichtsbuch Marienberg Nr.54 für das Annaberger und
Freiberger
Viertel 1587-1671, nach Blatt 139; laut Mtlg Kurt Wensch 1988.
17 Kunsthistorisches Museum Wien,
Münzkabinett,
2 Porträtmedaillen auf Hans Lemmel, 1583.
18 Bergarchiv Freiberg, Bergbuch des
Amtes Geyer
(1529-1640) Rep.62 Sect.XXXV Nr.17 Raum 10, und zwar S. 76b, 85b, 86a,
229b. - Mtlg K.Schröpel 1995.
19 Hans-Dietrich Lemmel: Regesten und
Stammfolgen
der Bergunternehmerfamilie Lemmel in Marienberg im Erzgebirge
1520-1750. Lemmel-Verlag, A-1170 Wien, Handlirschgasse 14.
20 Bergbaumuseum in Kongsberg, Norwegen;
"Norwegische Bergwerksordnung", Zwickau 1540. - Die deutsche
Einwanderung in Kongsberg, Heft 1 der Beiträge zur Geschichte
des
Deutschtums in Norwegen (ohne Datum, etwa um 1943).
20a Lisa Kaiser: Die oberste
Bergverwaltung
Kursachsens im 16.Jh, in: Forschungen aus mitteldeutschen Archiven,
Berlin 1953, S.255ff.
20b Holzschnitt abgedruckt in der
Süddeutschen
Zeitung vom 5.12.1991.
21 Besitznachfolger von Caspar Lemmel
war Hans
Clausnitzer, dessen Besitz in Thum beschrieben wird. Helene Hoffmann:
Tobias Clausnitzer ...; in: Zeitschrift für bayrische
Kirchengeschichte Bd.29, Neustadt/Aisch 1960.
22 Siehe die Abbildung der
Lämmelschen
Amerika-Medaille in "lemlein filii" Heft 5 Seite 42.
23 Bergarchiv Freiberg, Bergbuch des
Amtes Geyer,
Rep.62 Sect.XXXV Nr.14 Raum 10, unter "Gewerken" des "Bergk
Städtleins Zwenz" (= Zwönitz) S. 14, 16b, 35b. - Mtlg
K.Schröpel 1995.
24 Siehe die Abbildung des
Goethe-Porträts von
Moritz Lämmel in "lemlein filii" Heft 5 Seite 43.
25 Siehe die Abbildung des
Lämmelschen
Abendmahlgerätes in "lemlein filii" Heft 5 Seite
46.
Ergänzung: Die sächsischen Lemmel-Urkunden des 15.
Jahrhunderts
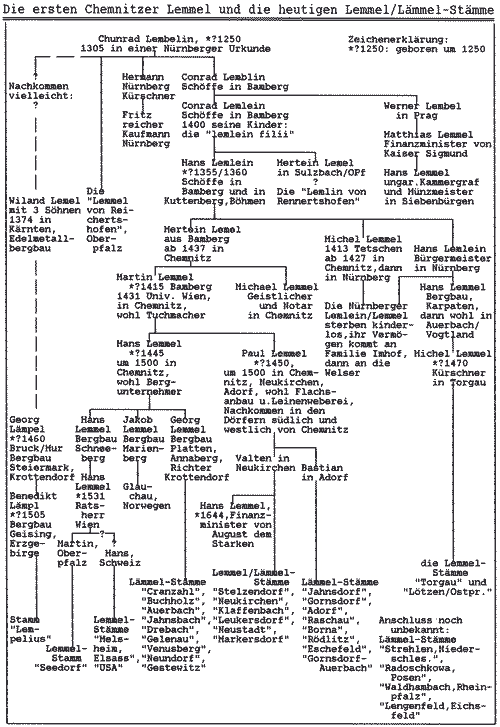
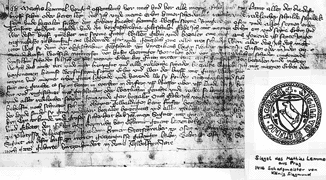 2
2 3
3


 Der Chemnitzer
Hauptmarkt [Titelbild von "Familie und Geschichte" Heft
Nr.36 2001]
Der Chemnitzer
Hauptmarkt [Titelbild von "Familie und Geschichte" Heft
Nr.36 2001] 2
2 3
3