 Johann Lämmel
(1644-1705) -
sächsischer Generalkriegszahlmeister
von Hans-Dietrich Lemmel
Johann Lämmel
(1644-1705) -
sächsischer Generalkriegszahlmeister
von Hans-Dietrich Lemmel
Gedruckt in: Zeitschrift
für mitteldeutsche Familienforschung 58.Jg. (2017) Heft 4
Seiten 178-191.
Hier: einige
zusätzliche Abbildungen und Links. Spätere
Ergänzungen sind mit < > gekennzeichnet.
1. Einleitung
In den 1990er Jahren besorgte mir der verdienstvolle Genealoge Kurt
Wensch
zahlreiche Auszüge aus dem Dresdener Staatsarchiv,
insbesondere
aus Gerichtsbüchern und Musterungslisten im Kriegsarchiv.
Daraus
ergab sich, dass um 1700 ein Dutzend Namensträger Lemmel und
Lämmel in der sächsischen Armee Dienst
taten,
worüber
ich einen Aufsatz "Die Familie Lemmel und August der Starke" (1)
verfasste. Der prominenteste dabei war Johann Lämmel (*1644, †1705),
der
seit 1680 General-Kriegszahlmeister unter drei sächsischen
Kurfürsten war. Inzwischen konnte ich zusätzliches
Quellenmaterial auffinden, aus dem unter anderem hervorgeht, dass
Johann Lämmel wesentlich dazu beitrug, dass August der
Starke
die polnische Königskrone errang. Er verdient es also, dass
ich ihm mit diesem Aufsatz ein Denkmal setze.
2. Die Eltern
Einzelheiten über Johann Lämmels Eltern ergeben sich
aus
Kirchenbüchern (2), Gerichtsbucheinträgen, sowie aus
den
Leichenpredigten (3) auf
Johann Lämmel selbst, auf seine
Mutter,
sowie auf seine Ehefrau.
Der Vater Hans Lemmel war ein Mälzer in Höckericht
bei
Chemnitz. 1637 kaufte er von seiner Schwiegermutter, der George
Kretzschmarin von Stelzendorf, eine Brandstatt (4). Es war
30-jähriger Krieg, und der Hof mag von plündernden
Soldaten
niedergebrannt worden sein. Aus der Ehe mit der Kretzschmarin stammen
zwei Töchter, Elisabeth, die 1657 in Niederrabenstein den Hans
Türcke, Bauer in Rottluff heiratete, und Maria, die 1659 in
Niederrabenstein den Tophl. Müller aus Rottluff heiratete. In
beiden Heiratseinträgen ist als Brautvater "Hans Lemmel in
Neustadt" angegeben, denn er lebte inzwischen in Neustadt, nachdem er
in zweiter Ehe, wohl um 1642, die Anna Neubert geheiratet hatte,
Tochter von Mattheus Neubert, Gärtner auf dem freiherrlichen
Taubischen Gut in Neukirchen, und der Elisabeth Arnold. Aus dieser Ehe
gab es fünf Kinder. Der älteste, Johannes, wurde
am 18.4.1644 im Elternhaus der Mutter auf dem Taubischen Gut *) in
Neukirchen geboren und am 19.4. in der Neukirchener Kirche getauft. Er
ist der spätere Kriegsrat. Die weiteren Kinder wurden in
zweijährigen Abständen in Neustadt geboren und in der
Chemnitzer Niklaskirche getauft, und zwar: Andreas, der nach 8 Monaten
starb; Georg, der 29-jährig starb und von dem eine posthume
Tochter "Rosina Lämbel" am 15.7.1677 in der Chemnitzer
Johanniskirche getauft wurde; dann Franz, der als Nachfolger des Vaters
als Mälzer und Schöffe in Neustadt lebte; und Regina,
geboren
1652 und 1672 in Chemnitz-Nicolai mit dem Witwer Nicol Herold aus
Schönau verheiratet.
Die Herkunft des Mälzers Hans Lemmel ist unsicher. Nach
Durchsicht
aller einschlägigen Kirchenbücher muss er in einem
Ort geboren
sein, wo um und nach 1600 keine Taufbücher existieren. Da
kommt
als sein Vater nur ein Hans Lemmel in Frage,
der 1601 als Sohn eines
Franz Lemmel in Niederrabenstein die Walpurgis Neuber heiratete. Dieser
Franz Lemmel ist einer der 29 bekannten Urenkel des Paul Lemmel, der um
1450 in Chemnitz geboren wurde und Bauerngutsbesitzer in Neukirchen und
Adorf wurde, wo er sechs Söhne bekam (5).
Laut Leichenpredigt auf seine Frau starb der Mälzer Hans
Lemmel,
jetzt in der Schreibweise Johann Laemmel, am 17.10.1671 in Chemnitz.
Seine Frau Anna geborene Neuber starb in Chemnitz am Morgen des
17.10.1677, im Alter von 61 Jahren und 6 Wochen (6).
Als "Mälzer" war
Hans Lemmel sowohl
Malzproduzent als auch
Malzhändler. Man muss sich vorstellen, dass er in Neustadt ein
Haus mit Garten nebst Pferd und Wagen besaß, dass er
bei den
Bauern Gerste einkaufte, die er in einem
Lagerraum zum Keimen brachte, dann vergären und
rösten musste, bis er das so entstandene Malz an die
Chemnitzer Bierbrauer liefern konnte.
Wie kam nun Johannes Lemmel, Sohn eines
Malzhändlers, zu dem Amt des General-Kriegszahlmeisters?
< *) Zum v.Taube'schen Gut in Neukirchen vergl. http://geneal.lemmel.at/vT-30/j.html
>
3. Der
Werdegang
Über seinen Werdegang wird in seiner
Leichenpredigt berichtet. Johann Lämmel, der bei den
Eltern Schreiben und
Rechnen
gelernt hatte, ging zum Neujahrsmarkt 1656, also knapp
12-jährig,
nach Leipzig in die Lehre bei dem Handelsmann und Ratsherrn Zacharias
Crahmer, bei dem er 13 Jahre blieb. Die letzten fünf Jahre
wurde
er als Handelsdiener mit Auslandsreisen betraut, u.a. "nach Polen,
Wilda, Ukraine, Litauen". (Mit Wilda dürfte Wilna in Litauen
gemeint sein.)
1668, wohl anlässlich der Beendigung seiner Ausbildung, wird
der "Handelsbediente Johann Lemmel in Leipzig" als
ein
Wohltäter der Chemnitzer Nicolaikirche erwähnt, der
dieser
Kirche "ein grün taffetnes Altartuch verehret" hatte.
Noch 100 Jahre später wird diese Stiftung in
der Richter'schen Chronik von Chemnitz
von 1767 (7) erwähnt. Wobei der Chronik-Schreiber offenbar
nicht
wusste, dass dieser Handelsbediente der spätere Kriegsrat war.
Er "demissionierte" dann bei Crahmer und heiratete
am 16.7.1669 in Dresden die Jungfrau
Aemilia, Tochter
von Benedict Thomae, königlich schwedischer
Regiments-Quartiermeister in Meißen, und bekam in den
folgenden Jahren 1670-1677 drei Töchter. Wohl durch
Vermittlung
des Schwiegervaters gelangte er in
Dresden
in den
Dienst des Kurprinzen Johann Georg, und zwar zunächst als
"Hof-Handelsmann", dann 1671 als "Fourier" bei der Kurprinzlichen
Leib-Garde zu Fuß, dann als Regiments-Sekretär des
Kurprinzlichen Kürassier-Regiments. 1673, als sein Regiment
mit der kaiserlichen
Armee zur Unterstützung Wilhelms von Oranien gegen Frankreich
zog, war Johann Lämmel Regiments-Quartiermeister.
1677 besuchte er seine kranke Mutter in Chemnitz, und in ihrer
Leichenpredigt wird er "Herr Regiments-Quartiermeister" tituliert.
1680, als der Kurprinz Kurfürst
wurde,
als Johann Georg der III., wurde dem Johann
Lämmel die
"Kriegs-Casse anvertraut". Im Alter von 36
Jahren wurde er General Kriegs-Zahlmeister, der nun in
der Umgebung von
Dresden
die Rittergüter
Klein-Carsdorf und Deusewitz (= Theisewitz) sowie das Erbschenkgut zu
Possendorf mit Vorwerk Wilschdorf
erwarb (8).
4.
Türkenkriege
Johann Lämmel lebte nun auf dem Rittergut
Klein-Carsdorf bei
Possendorf, 10 Kilometer südlich von Dresden. Um 1680
rückten
die Türken Richtung Wien vor, und in der Verteidigung war auch
sächsisches Militär involviert.
In diese Zeit fällt eine denkwürdige Taufe in
Possendorf. Der Herr Hoë
von Hoënegg
hatte als kaiserlicher Obrist-Leutnant bei Raab in Ungarn gegen die
Türken gekämpft und von dort ein 14-jähriges
Mägdlein mitgebracht, das "griechisch und welsch" reden
konnte. Er
wusste aber nicht, ob und wie sie getauft war. Und so wurde sie am
Johannistag 1680 in Possendorf getauft, wobei im Kirchenbuch
(9)
die erstaunliche Anzahl von 15 Taufpaten eingetragen wurde. Unter ihnen
stehen an 13ter Stelle "Herr Johann
Lämmel, ChurPrinz Durchl. zu Sachßen bestalter
Quartiermeister und Secretarius" und schon zuvor
an 7ter Stelle seine Frau Emilia.
Als 1683 die Kaiserstadt Wien von den Türken belagert
wurde, brachte der Polenkönig Jan Sobieski mit seinem
Heer
die Rettung. Es
war aber nicht nur Polen
sondern auch Kursachsen unter Johann Georg
dem III., der seine ganze
Armee nach Wien schickte, so dass es gelang, in der Schlacht am
Kahlenberge die Türken zu besiegen und Wien zu befreien.
Während dieses Kriegszuges veranlasste der "Herr General
Kriegs-Zahlmeister Lämmel", Gottfried Jentzsch aus
Oschatz zum Feldprediger zu berufen. <Jentzsch hatte zuvor in
Dresden Lämmels Kinder unterrichtet>
(10).
1686 gingen fünf sächsische Regimenter
nach Ungarn gegen die
Türken. Johann
Lämmel, der der Eroberung Ofens persönlich beiwohnte
und
nicht nur die sächsischen Truppen sondern hier auch die
Truppen von
Kaiser Leopold versorgte, wurde zusätzlich
zu
seinem
Zahlmeister-Amt auch zum Proviantmeister ernannt. - < 1687
findet
sich im Etat der Kursächsischen Armee der Posten
"Generalkriegszahlmeister Lämmel - 70 Rtlr" (10a).
>
Einige Türken kamen in Gefangenschaft, und so
wurde am 9.10.1687 in der Leipziger Nikolaikirche ein
19-jähriger
Türke namens Ismael auf den christlichen Vornamen Johann
Friedrich
getauft (11). Sein Taufpate war Herr Johann Lemmel,
Churfürstlich
Sächsischer General-Kriegszahlmeister. Auch
in Possendorf bei Dresden wurden am 21. Mai 1689 zwei
türkische Mädchen getauft (12). Dabei
heißt es im
Taufbuch: "Nachdem
die Stadt Ofen in Ungarn den
24. Julij 1686 den Erbfeinden Christ. nahmens
den
Türcken wieder abgenommen und von denen Christ.
Völckern
erobert worden, .. hat der Churfürst.
Sächß. Hochbestalte Herr General Kriegs Zahlmeister
in
Dreßden, Herr Johannes Lämmel, Erb- und Lehns Herr
auff
Carßdorff und Theißwitz pp., zwei Türcken
Mägdlein gefänglich mit sich anher gebracht, und von
selber
Zeit her sie beijderseits ... in dem Heil. Cathechismo Lutheri
gründtlich unterrichten" lassen. Sie wurden auf die Namen
Dorothea
Christiana und Christiana Margarethe getauft. In Abwesenheit einer
vorgesehenen Taufpatin, der Ehefrau des Diakons Kirbisch, stand stellvertretend
die Jungfer Johanna Margaretha Lämmelin Pate.
Im Wiener Kriegsarchiv wird in einer Aufstellung von 1690 (13)
Johann Lämmel als einer von zwölf Generälen
der
sächsischen Armee aufgeführt. Die
Generäle sind
etwa zur Hälfte adeligen Standes und zur Hälfte
bürgerlich. Damit hat die sächsische Armee dieser
Zeit einen
erstaunlich hohen bürgerlichen Anteil in der
Führungsschicht.
Unter den adeligen war Generalmajor v.Minkwitz, dessen Sohn Johann
Georg später Johann Lemmels Tochter Johanna Margarete
heiratete.
<
 Die kursächsischen
Generäle 1690 >
Die kursächsischen
Generäle 1690 >
In seinem Wohlstand gedachte Johann Lämmel
auch seiner
Heimat. Die Chemnitzer Nikolaikirche bekam 1692 eine neue Glocke mit
der Aufschrift "Andreas Herold in Dresden goss mich,
1692, Johann Laemmel C.S. General Kriegs Zahlmeister" (14).
< Die alte Nikolaikirche in
Chemnitz mit der Laemmel-Glocke. [Postkarte]>
Die alte Nikolaikirche in
Chemnitz mit der Laemmel-Glocke. [Postkarte]>
5. August der Starke
1691 starb Kurfürst Johann Georg der III. Sein
ältester
Sohn, Johann
Georg der IV., starb schon drei Jahre später, so dass 1694
sein
jüngerer Bruder, Friedrich August, Kurfürst wurde,
genannt
August der
Starke. Johann Lämmel wurde von beiden in seinem Amt als
General-Kriegs-Zahlmeister bestätigt.
Alsbald ergab sich für August die Möglichkeit, sich
zum
König von Polen wählen zu lassen, und dazu hat Johann
Lämmel einiges beigetragen.
Am 17. Juni 1696 war König Jan
Sobieski, der Sieger der
Schlacht am Kahlenberg, gestorben. In Polen gab es ein
Wahlkönigtum, und für
Sobieskis Sohn gab es keine Mehrheit. August der Starke bereitete
sich für die Kandidatur vor, und das war ein finanzielles
Problem.
Die Bestechungsgelder, die August der
Starke
für seine Wahl zum König von Polen fließen
ließ, gingen in die Millionen, zumeist durch den "Hofjuden"
Bernd Lehmann, aber auch durch Johann Lämmel. Darüber
gibt
es einen
Aufsatz von Paul Haake von 1906
(15), der u.a. auf Briefen
des
kursächsischen Feldmarschalls Graf von Flemming basiert.
Im April
1696 musste Lämmel 100ooo Taler aus der Generalkriegskasse
herausgeben, zur
Begleichung von Augusts Schulden und zur Einlösung von
Pfändern.
Auch der Rat der Stadt Zittau musste 100ooo Taler beitragen. August
verkaufte das Gut Pillnitz an seine Mutter für 15ooo Dukaten.
Im April/Mai 1697 verzichtete August
gegenüber Ernst
August von Hannover und Georg Wilhelm von Celle auf seine
Ansprüche
auf das Herzogtum Lauenburg, für eine Million Gulden. Weitere
ähnliche Projekte folgten. Für
diese Finanztransaktionen waren die engsten
Vertrauten
der Graf von Flemming, der Baron von Löwenhaupt,
der Hofjude
Berent Lehmann, und der Kriegszahlmeister Lämmel. Sie waren
von
der Kontrolle durch die sächsische Finanzcommission befreit.
Für Lämmel bemerkte August, "in seinen Rechnungen
befänden sich auch fielle sachen, so ich nicht gerne
sehe,
das die commission sie zu sehen bekehme" (16).
Am 1.Juni 1697 trat August in Baden bei
Wien zum
Katholizismus über. Er versetzte seine Juwelen bei den Wiener
Jesuiten, die ihre Brüder in Warschau veranlassten, den
polnischen
Magnaten Vorschüsse auf Rechnung Augusts bis zur Höhe
von einer
Million zu versprechen.
Das alles half zunächst nichts. Im
Juni 1697
versammelten sich die wahlberechtigten polnischen Magnaten in
Warschau. Unter den Kandidaten waren die Söhne des vorigen
Königs
Sobieski, ein Prinz Conti, der von Ludwig dem XIV. unterstützt
wurde,
Kurfürst Max Emanuel von Bayern (Sobieskis Schwiegersohn), der
Herzog von Lothringen, der Pfalzgraf von Neuburg, aber
nicht der Kurfürst von Sachsen.
In letzter Minute, im Juni 1697, schickte
August
seinen Kriegszahlmeister Lämmel und den Juden Bernd Lehmann zu
den
sechs Städten der Oberlausitz, von denen 30ooo Taler
eingetrieben
wurden. Am Nachmittag des 26.
Juni trafen Lämmel und Lehmann in Warschau ein, mit
40ooo Talern baren Geldes, welches
schleunigst ausgepackt und unter den polnischen Magnaten verteilt
wurde. So berichtet es P.Haake (15) aufgrund von Briefen von
Augenzeugen. Darauf schwenkten die Sobieski-Anhänger
großenteils um auf die Seite Augusts. Aber die Versammlung
war
zerstritten, und der eine Teil rief den Prinzen Conti, ein anderer Teil
August zum König aus. Beide nahmen die Wahl an. Nun hatte
August den
geografischen Vorteil. Am 6. Juli betrat er mit einer Truppe
polnischen Boden, zog am 12. September in Krakau ein und ließ
sich
krönen, 27 Jahre alt. Derweil erschien der
französische Konkurrent
Conti mit
einer Flotte auf der Ostsee bei Danzig, von wo er aber im November von
sächsischen Truppen vertrieben wurde.
Johann Lämmel, 53 Jahre alt, war nun
nicht nur
kurfürstlich
sächsischer sondern auch königlich polnischer
General-Kriegszahlmeister. Er ließ
sich
in einer
prächtigen
Rüstung porträtieren, und ein nach dem
Porträt
angefertigtes Schabkunstblatt (17) befindet sich im Dresdener
Kupferstich-Kabinett; es hat die Inschrift "Johann Læmmell,
Potentissimi Regis et Electoris Saxoniæ Consiliarius Belli
intimus"; zu deutsch etwa: "Des allermächtigsten
Königs und
Sachsens Kurfürsten Geheimer Kriegsrat".
 Johann
Lämmel (1644-1705), Königlich polnischer und
Kurfürstlich sächsischer Geheimer Kriegsrat.
Schabblatt
(270x190mm) von Pieter Schenk (1660-1718/19) nach Samuel Bottschild.
(Kupferstichkabinett Dresden). Vgl. Anm. 18.
Johann
Lämmel (1644-1705), Königlich polnischer und
Kurfürstlich sächsischer Geheimer Kriegsrat.
Schabblatt
(270x190mm) von Pieter Schenk (1660-1718/19) nach Samuel Bottschild.
(Kupferstichkabinett Dresden). Vgl. Anm. 18.
Die Ernennung zum
"Geheimen Kriegsrat" erfolgte, laut Leichenpredigt, 1701. Das
Porträt, also nach 1701 zu datieren, wurde
von Pieter Schenk angefertigt, der etwa in dieser Zeit auch
die
Gräfin Cosel, die wichtigste Mätresse von August dem
Starken,
porträtierte. Die Mätressen waren
wichtig. Ein Schreiben
(18) von 1704 des Livländischen Staatsmannes Johann Reinhold
von
Patkul an den Kriegsrat Lämmel in Dresden anempfiehlt ihm
Gefälligkeiten gegen die (Mätresse) Lubomirska; man
könne sich dadurch beim König "in guten Kredit
setzen".
Das muss gewirkt haben, denn als später
die Gräfin
Cosel an
die Stelle der Lubomirska trat, kam Patkul in
größere
finanzielle Schwierigkeiten (18). – Solche
"Gefälligkeiten" muss
es viele gegeben haben, und es ist sicher nicht die Regel, dass es
dafür, wie in diesem Fall, einen schriftlichen Beleg gibt.
< Pieter Schenk: Bildnis der Gräfin Cosel. [Internet 2024, Digitaler Porträtindex]>
Pieter Schenk: Bildnis der Gräfin Cosel. [Internet 2024, Digitaler Porträtindex]>
6. Die Niederlage
1698 empfing August der Starke in einem Schloss bei Lemberg,
das nun
zu seinem Reich gehörte, den Zaren Peter den
Großen. Beide
verständigten sich über einen Kampf gegen Schweden,
das die
stärkste Macht im Norden war und fast das gesamte
Ostsee-Umland
beherrschte. August zog mit seiner Armee quer durch Polen nach
Litauen,
das ebenfalls zu seinem Reich gehörte. Von hier aus versuchte
er
im Februar 1700, den Schweden die Stadt und Festung Riga abzunehmen,
wobei er aber von dem 20-jährigen Schwedenkönig Karl
dem XII.
vernichtend geschlagen wurde.
Unter Augusts Soldaten war ein Johan Georg Lemmel (nur sehr
weitläufig verwandt mit Johann Lämmel). Der lief zu
den
Schweden über, wurde im Livländischen
Kavallerie-Regiment des
Generals von Tiesenhausen "Volontär", dann Kornett, Leutnant,
Rittmeister, und starb 1719 in einem Feldzug gegen Trondheim (19).
Nach der Niederlage bei Riga wurde Johann Lämmel zum
Geheimen
Kriegsrat ernannt (20), aber er konnte das Blatt auch nicht mehr
wenden. Als August der
Starke
auf dem Rückzug in der
Garnison von Posen seine Truppen sammelte, wurde Johann
Lämmels
Schwiegersohn, der Oberst Otto Heinrich von Egidy, am
30.11.1702 von dem Starosten Gembinski "mördlich
überfallen und
ums Leben gebracht". Angeblich hatte der Mordanschlag dem
König
gegolten, denn August und Egidy sollen einander in Gestalt und Gesicht
geähnelt haben (21).
 "Des
Europäischen Tag-Registers ... über das
Jahr 1702 ..." [Leipzig 1702]
"Des
Europäischen Tag-Registers ... über das
Jahr 1702 ..." [Leipzig 1702]
1706 musste August abdanken und auf die polnische Krone verzichten.
Aber als es dem Zaren Peter doch noch gelang, den
Schwedenkönig
zu schlagen, wurde August der Starke bereits 1709 zum zweiten
Mal zum König von Polen gekrönt. Aber das erlebte
Johann
Lämmel nicht mehr; er war im Jahre 1705 im Alter von 61 Jahren
gestorben.
Nebenbei: Das Beispiel des sächsischen
Kurfürsten
August, der die polnische Königskrone errang,
dürfte dazu beigetragen haben,
dass sein
brandenburgischer Kollege, Kurfürst Friedrich der
III., sich
1702 in
Königsberg eine Königskrone aufs Haupt setzte, als
König
in Preußen, das bis 1660 ein polnisches Lehen gewesen war.
7. Ein
Finanzproblem
Um 1700 gab es noch keine Finanzämter. Wenn ein
Fürst
Geld brauchte, lieh er es sich von jemandem und verpfändete
ihm
dafür bestimmte Einkünfte, die der Geldgeber dann
selbst
einziehen musste. Normalerweise konnte der Geldgeber mehr Geld
eintreiben als er zuvor dem Fürsten geliehen hatte. So hatte
der
Geldgeber ein gutes Geschäft gemacht und der Fürst
war der
Sorge enthoben, selbst in seinem Land die Steuern einzutreiben.
So reiste im Jahre 1703 "der Geheime Kriegs-Rath Johannes
Lämmel"
mit Pferdegespann, Schatztruhe und Wachmannschaft von Dresden nach
Leipzig. August der Starke hatte dem dortigen Oberpostmeister Johann
Jakob Keeß (22) die Einkünfte der Post für
160ooo
Taler verkauft und Lämmel sollte dieses Geld nun für
den
König in Empfang nehmen.
In Leipzig residierte Egon Anton Fürst zu Fürstenberg
als
Statthalter Augusts des Starken. Offenbar unterließ es
Lämmel, den Fürsten über seinen
Geldtransport zu
unterrichten; oder aber August der Starke hatte seine Leipziger
Posteinkünfte nicht nur einmal sondern doppelt
verpfändet, was bei August öfters
vorgekommen sein soll.
Lämmel war jedenfalls der schnellere. Als der Fürst
ebenfalls vom Oberpostmeister Keeß 160ooo Taler einforderte,
schrieb dieser zurück, dass sich "der Herr Geh. Kriegs-Rath
Lämel" schon in Person eingefunden und das Geld
entgegengenommen habe. Pech für den Fürsten. Kurz
darauf
verstarben sowohl Lämmel als auch Keeß, und der
Fürst
von Fürstenberg bedrängte sowohl die
Keeßschen Erben
als auch die Lämmelschen Erben wegen der 160ooo
Taler. Der
Schriftwechsel erstreckte sich bis 1712. Zum Schluss aber, sieben Jahre
nach
Johann Lämmels Tod, wurden "die Lemmelischen Erben allen
Anspruchs
entnommen". Es wurde also bestätigt, dass
Johann
Lämmel alles ordnungsgemäß abgewickelt
hatte.
Der Oberpostmeister Keeß muss jedenfalls gut verdient haben,
denn
zum Trauergottesdienst nach dem Tod seiner Witwe 1723 gaben die Erben
einen Auftrag an Johann Sebastian Bach, der darauf die
Motette "Jesu, meine Freude" (23) komponierte.
8. Waffenhandel
1702 war Johann Lämmel bei einem Sohn des Dresdener
Büchsenschäftlers Gottfried Escher Taufpate gewesen
(24),
wodurch ein enger Kontakt mit einem Waffenfabrikanten dokumentiert
wird.
Über
die Finanzierung hinaus war Johann Lämmel auch mit der
Beschaffung von
Waffen befasst. Im Jahre 1703 erteilte der
Kurfürst dem Geheimen
Oberkriegsrat
Lämmel den Befehl, zur Errichtung einer Gewehrfabrik in
Olbernhau
auswärtige Kräfte heranzuziehen (25). Darauf
berichtete Lämmel, dass
er sich gegen 50 Personen, Büchsenmacher und Rohrschmiede,
"aus
fremden Territoriis (vermutlich Suhl und Umgegend) verschaffet, welche
sich insgesambt auf seine
Persvasion in gedachtem Olbernhau niedergelassen".
Johann Lämmel muss einen europaweiten
Waffenhandel
betrieben haben, und zwar privat, denn nach seinem Tod sind es seine
Erben, die sich um Außenstände bemühen
müssen
(26). Da geht es insbesondere um Lieferungen an den Zaren, und zwar
Lieferungen von 100 Pistolen aus Amsterdam, 700 Pistolen aus Suhl,
sowie eine Pallasch-Klinge(27) mit des Zaren Wappen. Die
Witwe musste sich um ausstehende Geldbeträge
kümmern.
Den Umfang des Lämmelschen Waffenhandels kann man daraus
ermessen,
dass Aufforderungen zur Rückzahlung von
Verbindlichkeiten an
viele Adressaten gingen, nicht nur in Sachsen sondern
auch nach Prag, Frankfurt/Main, Lüttich, Amsterdam, Hannover,
Bremen, Hamburg, Danzig, Moskau.
9. Johann Lämmels
Gutsbesitz
In Klein-Carsdorf ließ Johann Lämmel an
einem
Kachelofen eine eiserne Platte mit seinem Familienwappen anbringen
(28). Die Platte wurde im Hammerwerk Bahra bei Pirna von dem
Schneeberger Bildhauer Johann Heinrich Böhme angefertigt, der
1675
am Dresdener Hof arbeitete (29).
Lämmels Wappen (30) zeigt ein Lamm in der unteren
Hälfte
des
Schildes unter einem belaubten Zweig in der oberen Hälfte.



 Kachelofen aus Klein-Carsdorf mit dem Familienwappen des Johann
Lämmel an der linken Seite unten (Staatliche Kunstsammlungen
Dresden, Kunstgewerbemuseum, Inv.-Nr.26837); Ofenplatte angefertigt von
dem Schneeberger Bildhauer Johann Heinrich Böhme im Hammerwerk
Bahra bei Pirna. - Umzeichnung des Wappens durch H.D.Lemmel.
Kachelofen aus Klein-Carsdorf mit dem Familienwappen des Johann
Lämmel an der linken Seite unten (Staatliche Kunstsammlungen
Dresden, Kunstgewerbemuseum, Inv.-Nr.26837); Ofenplatte angefertigt von
dem Schneeberger Bildhauer Johann Heinrich Böhme im Hammerwerk
Bahra bei Pirna. - Umzeichnung des Wappens durch H.D.Lemmel.
Am 10.7.1687 feierte Johann Lämmel die
Hochzeit seiner Tochter Johanna Rahel mit dem
kurfürstlich-sächsischen Oberst Otto Heinrich von
Egidy auf Badrina in Nordsachsen (31).
Ein Jahr später musste er am 24.7.1688 den Tod seiner Frau
erleben. Sie wurde am 1.8. "in ihr zubereitetes Gewölbe oder
Schlaff-Cämmerlein unter der Kirchen-Empore bey der Cantzel"
in
Possendorf beigesetzt (32).
Etwa um diese Zeit wurde an der Possendorfer Kirche das
"Kleincarsdorfer Betstübchen" angebaut, und zwar an der
Stelle, wo
heute die Sakristei mit dem darüber liegenden
Konfirmandenzimmer
sich befindet. Das Betstübchen wurde an die andere Seite des
Kirchenschiffes verlegt. Dort sieht man heute über einem
Fensterbogen einen Schlussstein mit dem Lämmelschen Wappen,
das
dem auf der Ofenplatte gleicht, jedoch zusätzlich die
Initialen J
L
zeigt. Womöglich hatte Johann Lämmel
anlässlich des
Todes seiner Frau das Betstübchen gestiftet und daran sein
Wappen
anbringen lassen (33).
 Schlussstein mit dem Lämmelschen Wappen am "Klein-Carsdorfer
Betstübchen" der Possendorfer Kirche mit den Initialen J L.
Schlussstein mit dem Lämmelschen Wappen am "Klein-Carsdorfer
Betstübchen" der Possendorfer Kirche mit den Initialen J L.
Auf
seinem Possendorfer Gutsgelände ließ
Johann Lämmel im Jahre
1691 auf dem Käferberg eine
Holländer-Windmühle errichten (34a), die noch heute
eine Touristenattraktion bildet (34b).
 Holländer-Windmühle auf dem Käferberg bei
Possendorf (34b)
Holländer-Windmühle auf dem Käferberg bei
Possendorf (34b)
Am 9.6.1693 heiratete Johann Lämmel in
Wittenberg in
zweiter
Ehe die Justina Sayfried, Witwe des Amtmannes Christian Jahn
und Schwester des Chemnitzer Ratsherrn Christian Albinus Seyfried
(35).
1699
wurde
der Kirchturm von Possendorf
vom ersten Gesims aufwärts erhöht. Dazu wurde der
erste
Quaderstein gelegt "von dem über diesen Bau bestellten
Inspector
Christian Michael Albrecht, derzeit Verwalter bei dem Kriegsrat und
General-Kriegszahlmeister Johann Lämmel".
Die Baukosten beliefen sich auf 2000 Taler incl. zwei neuer Glocken. Zu
den Kosten trug der Churfürst außer dem
nötigen Bauholz 200 Taler bei. "Johann Lämmel,
damaliger Besitzer der beiden Güter Klaincarsdorf und
Theisewitz,
wie auch der Schänke in Possendorf, gab 100 Taler."
(36)
In einer Art "Who is who" in Dresden von
1702, einem Buch unter dem Titel "Das jetzt lebende Dreßden" (37),
wird
"Johann Lämmel auff Carsdorff und Theißwitz" unter
den
"Geheimbten Kriegs-Räthen" als "General-Proviant- und
Kriegs-Zahlmeister" angeführt.
 "Königlicher Kriegs-Rath" Dresden 1702
"Königlicher Kriegs-Rath" Dresden 1702
10. Johann
Lämmels
Tod und Nachfahren
Laut seiner Leichenpredigt war er am 2.5.1705,
schon krank, zur Messe nsch
Leipzig gereist, wo er am 26.5. starb. Der Eintrag im Leipziger Ratsleichenbuch
(38) lautet: "Ein Mann, 60 Jahre alt, Herr Johann
Lämmel,
kgl. Poln. und churf. Sächs. Hochbestellter und Geheimer
Kriegsrat
sowie Kriegszahlmeister von Dresden, allhier vom Neumarkt, abgeholt am
29.5.1705." Die Beisetztung erfolgte "in
seiner vorlängst ausgesehenen
und
ausgebaueten Ruhestätte in der von dem seligen Manne iederzeit
so
werthgehaltenen Kirche zu Possendorff". In diesem
Gewölbe
wurde am 19.2.1712 auch Johann Lämmels kleiner Enkel, Wilhelm
Christian Nerger, begraben (39).
Die Witwe und die
Schwiegersöhne
erster Ehe führten nun einen umfangreichen Schriftwechsel, der
in
einem 400-seitigen Akt erhalten ist: "Protocollum gehalten
nach
des seel. Herren Geheimbden Kriegs-Rath Lämmels
tödlichen
Hinritt" (40). Zunächst wird die Todesnachricht an eine Liste
von 28
Adressaten
verschickt, darunter der Bruder "Franz Lämmel bey
Chemnitz". Dann bitten die Erben Seine Majestät, die
Prüfung der Rechnungssachen des Verstorbenen beschleunigen zu
lassen, und zu verfügen, dass am 2.Juli in der Sophienkirche
durch
Oberhofprediger Carpzov eine Gedächtnispredigt gehalten werde.
Zur prachtvollen
Beisetzung gaben die Bankiers Gottfried Otto
und Friedrich Weiß ein Darlehen von 1000 Talern.
<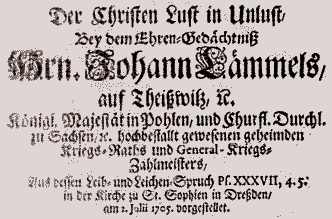 Die gedruckte Leichenpredigt
auf Johann Lämmel. Ausschnitt der Titelseite. Sammlung
Stolberg LP3129.>
Die gedruckte Leichenpredigt
auf Johann Lämmel. Ausschnitt der Titelseite. Sammlung
Stolberg LP3129.>
Unter dem Personal, das nun größtenteils entlassen
wird,
finden
sich: Gotthelf Metzler aus Freiberg, Lakai; Johann Christian Trepte aus
Pillnitz, Gärtner und Lakai; Christoph Tröger aus dem
Amt
Frauenstein, Kutscher; Johann Volkmar Stockmann aus Suhl, Kellner und
Kellermeister; Andreas Neumann, Jäger; Meister Michael Andree,
"Hoffeueressenkehrer"; Christoph Seydel aus der
Herrschaft
Tetschen in Böhmen, Mälzer und Brauer auf der Schenke
zu
Possendorf; sein Nachfolger wird Hans George Bör von Lockwitz.
In
der Frau Kriegsrätin Diensten befinden sich noch: eine
Köchin, aus Torgau gebürtig; das "Mädgen"
von Bitterfeld; ein Kutscher aus dem Voigtland; ein Lakai von Leipzig.
Noch 1715 heißt es beim
Verkauf
des Rittergutes Sachsgrün, dass vom Kaufgeld die "Frau
Geheimte Kriegsräthin Lämmelin" mit 2285
Gulden und 15
Groschen zu befriedigen sei (41).
1714 verkaufen die Erben das Erbschenkgut Possendorf mit dem Vorwerk
Wilschdorf an Carl Gottlob v.Leubnitz für 10ooo Taler. Der
Käufer erhält auch die Gerichtsbarkeit, die bisher
dem Amt
Dippoldiswalde zustand. Aber noch 1727 läuft darüber
ein
Gerichtsakt des v.Leubnitz gegen Johann Lemmels Erben auf Badrina (42).
Die Witwe Justina Lämmel lebte noch lange; sie wurde am
13.9.1723
in Dresden beerdigt (43). Aus ihrer Ehe gab es keine Kinder, und so
kam
der Besitz an die drei Töchter der Ehe Lämmel-Thomae,
also an
die Familien der Schwiegersöhne v.Minkwitz, v.Egidy und
Nerger. Über die Erbteilung gibt es umfangreiche
Gerichtsakten. Die Erben
hatten das Erbschenkgut Possendorf mit dem Vorwerk Wilschdorf an
Oberhofjägermeister Carl Gottlob v.Leubnitz auf Olbernhau
verkauft; die darauf haftenden Hypotheken sollten von den Erben
gelöscht werden, was aber nicht geschehen war. Der Streit
wurde
von den Advokaten bis 1732 hingezogen.
Zu einem Gerichtstermin 1727 (44) sind die Erben namentlich
aufgeführt. Hieraus und aus der Leichenpredigt sind die
folgenden
Nachkommen ersichtlich. (Die beim Gerichtstermin Anwesenden habe ich
mit einem Stern * markiert.)
1. Die Tochter Johanna Margaretha Lämmel. Sie heiratete am
24.10.1692 den Oberstleutnant Georg Wilhelm Trosch; deren Tochter
Aemilia Engelburg Trosch starb jung. In zweiter Ehe heiratete sie am
21.4.1700 den Hans George v.Minckwitz, Amtshauptmann von Grimma. Vier
Kinder: Johanna Charlotte*, verheiratet vor 1727 mit einem
v.Hartitzsch; Johann Carl Eberhardt v.Minckwitz* auf
Niederpoyritz; George Friedrich (jung gestorben); und Rahel Christina
v.Minckwitz.
2. Die Tochter Johanna Rahel Lämmel, gestorben 1697. Sie
heiratete
am 10.7.1688 in Theisewitz den kurfürstlich
sächsischen
Oberst Otto Heinrich v.Egidy (45), der (wie oben erwähnt) am
30.11.1702 in Posen erstochen wurde. Söhne: Hans Otto v.Egidy
auf
Badrina (in Nordsachsen), verheiratet mit Charlotte Perpetua
v.Hartitzsch; der Hauptmann Samuel Heinrich v.Egidy*, verheiratet mit
Johanna Christina Brückner; sowie zwei jung gestorbene Kinder
Gottlob Alexander und Johanna Henriette v.Egidy.
3. Die Tochter Johanna Emilia Lämmel. Sie heiratete am
30.10.1693
den Oberstleutnant Christian Ehrenreich Nerger*. Sie lebten auf
Klein-Carsdorf und Theisewitz, wo sie am 13.5.1721 (sie) und am
31.1.1722 (er) starben (46). Fünf Kinder Nerger: Johanna
Aemilia;
Christian Ehrenreich*, Corporal bei der kgl. Leibgarde zu Pferde;
Johann Joachim*, kgl. Reitender Trabant, dann am
6.3.1731
als Garde-Wachtmeister in Kreischa verheiratet mit Maria
Büttner (47); Anna Catharina (Hellerin?) geb. Nerger*; sowie
der bereits erwähnte Knabe
Wilhelm Christian Nerger, der 1712 starb. - Außer diesen sind
beim Termin 1724 anwesend: Friedrich Ernst
Nerger*, Rahel Christiana Nerger* und Maria
Sophia Nerger*, deren Verwandtschaft aus der Leichenpredigt nicht
ersichtlich ist.
Für die Familie Lemmel sprang bei der
Erbschaft nichts heraus.
Johanns Bruder, der Mälzer Franz Lemmel in Chemnitz, hatte
1698
das sogenannte Kellerhaus in Schlosschemnitz gekauft, wo er gegen
Abgaben an die Chemnitzer Braugewerkschaft die Erlaubnis erhielt,
fremdes Weißbier auszuschenken. Er besaß zuletzt in
Chemnitz "das königlich sächsische Gut unter dem
Schlosse" (48),
das er womöglich durch Vermittlung seines ranghohen Bruders
bekommen hatte. Aber dieser Besitz blieb nicht in der Familie; die
beiden Söhne von Franz lebten in einfachem Stande, Hans
(*1687) als
Bäcker
in Chemnitz, und Christoph (*1691) als Bauer im nahegelegenen
Stelzendorf.
==============
 Johann Lämmel
(1644-1705) -
sächsischer Generalkriegszahlmeister
Johann Lämmel
(1644-1705) -
sächsischer Generalkriegszahlmeister Johann Lämmel
(1644-1705) -
sächsischer Generalkriegszahlmeister
Johann Lämmel
(1644-1705) -
sächsischer Generalkriegszahlmeister
 Die kursächsischen
Generäle 1690 >
Die kursächsischen
Generäle 1690 > Die alte Nikolaikirche in
Chemnitz mit der Laemmel-Glocke. [Postkarte]>
Die alte Nikolaikirche in
Chemnitz mit der Laemmel-Glocke. [Postkarte]> Johann
Lämmel (1644-1705), Königlich polnischer und
Kurfürstlich sächsischer Geheimer Kriegsrat.
Schabblatt
(270x190mm) von Pieter Schenk (1660-1718/19) nach Samuel Bottschild.
(Kupferstichkabinett Dresden). Vgl. Anm. 18.
Johann
Lämmel (1644-1705), Königlich polnischer und
Kurfürstlich sächsischer Geheimer Kriegsrat.
Schabblatt
(270x190mm) von Pieter Schenk (1660-1718/19) nach Samuel Bottschild.
(Kupferstichkabinett Dresden). Vgl. Anm. 18. Pieter Schenk: Bildnis der Gräfin Cosel. [Internet 2024, Digitaler Porträtindex]>
Pieter Schenk: Bildnis der Gräfin Cosel. [Internet 2024, Digitaler Porträtindex]> "Des
Europäischen Tag-Registers ... über das
Jahr 1702 ..." [Leipzig 1702]
"Des
Europäischen Tag-Registers ... über das
Jahr 1702 ..." [Leipzig 1702]


 Kachelofen aus Klein-Carsdorf mit dem Familienwappen des Johann
Lämmel an der linken Seite unten (Staatliche Kunstsammlungen
Dresden, Kunstgewerbemuseum, Inv.-Nr.26837); Ofenplatte angefertigt von
dem Schneeberger Bildhauer Johann Heinrich Böhme im Hammerwerk
Bahra bei Pirna. - Umzeichnung des Wappens durch H.D.Lemmel.
Kachelofen aus Klein-Carsdorf mit dem Familienwappen des Johann
Lämmel an der linken Seite unten (Staatliche Kunstsammlungen
Dresden, Kunstgewerbemuseum, Inv.-Nr.26837); Ofenplatte angefertigt von
dem Schneeberger Bildhauer Johann Heinrich Böhme im Hammerwerk
Bahra bei Pirna. - Umzeichnung des Wappens durch H.D.Lemmel. Schlussstein mit dem Lämmelschen Wappen am "Klein-Carsdorfer
Betstübchen" der Possendorfer Kirche mit den Initialen J L.
Schlussstein mit dem Lämmelschen Wappen am "Klein-Carsdorfer
Betstübchen" der Possendorfer Kirche mit den Initialen J L. Holländer-Windmühle auf dem Käferberg bei
Possendorf (34b)
Holländer-Windmühle auf dem Käferberg bei
Possendorf (34b) "Königlicher Kriegs-Rath" Dresden 1702
"Königlicher Kriegs-Rath" Dresden 1702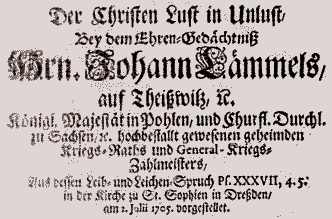 Die gedruckte Leichenpredigt
auf Johann Lämmel. Ausschnitt der Titelseite. Sammlung
Stolberg LP3129.>
Die gedruckte Leichenpredigt
auf Johann Lämmel. Ausschnitt der Titelseite. Sammlung
Stolberg LP3129.>