zurück
zum
Haupt-Index druckt mit Skal 67
Unsere Vorfahren im Königsberger Kneiphof
von Hans-Dietrich Lemmel
Gedruckt (etwas gekürzt) im Königsberger Bürgerbrief Nr.74, Dez.2009, Seiten 19-23, unter dem Titel
"Der Kneiphof - Geschäftsleute unserer Familie".
Siehe www.stadtgemeinschaft-koenigsberg.de
Hier im Web mit einigen zusätzlichen Abbildungen.
Kleine Ergänzungen bis 2021.
Lieber Leser! Kommst du nach Kaliningrad, begib dich auf die große Straßenbrücke, die beide Pregelarme und die ganze Pregelinsel überspannt.
 (Foto
1991)
(Foto
1991) Stelle dich mitten auf die große Brücke und blicke hinunter. Hier, wo jetzt nichts ist als eine baumbestandene Wiese, mit dem wieder aufgebauten Dom im Hintergrund, gab es über mehr als sechs Jahrhunderte hindurch das geschäftige Leben der Kaufmanns- und Hansestadt "Kneiphof", die ursprünglich selbständig war und erst 1724 mit der nördlich des Pregels gelegenen Königsberger Altstadt vereinigt wurde. Diese Hansestadt ist verschwunden wie Atlantis oder Vineta. So gründlich verschwunden ist keine andere Stadt der Neuzeit. Nur der Dom, das einzige verbliebene Bauwerk dieser Stadt, gibt Zeugnis von den Menschen, die hier einmal lebten und im Dom ihre Trauungen, Taufen und Trauerfeiern begingen. Beim Glockengeläut des Domes kannst du davon träumen, wie unter der großen Brücke die prominenteste Geschäftsstraße Königsbergs verlief, die "Kneiphöfische Langgasse" mit den alten Kaufmannshäusern und ihren Speichern im Hintergrund am Pregelufer, wo die Handelsschiffe entladen wurden.

Auf der Pregelinsel lag die alte Hansestadt Kneiphof mit der Kneiphöfischen Langgasse (Kn.Lg.) und dem Dom.

Die Kneiphöfische Langgasse 1864, Blick nach Süden
[Postkarte gedruckt im Königsberger Bürgerbrief Nr.77, 2011, Ausschnitt]

Die Kneiphöfische Langgasse, um 1900, Blick nach Norden
1.
 2.
2.
1.Die Speicher am Pregelufer -- 2.Königsberger Pferdebahn
1879 kaufte unser
Großonkel Paul
Lemmel das Haus Nr.41 in der
Kneiphöfischen Langgasse und eröffnete hier ein
Wein-Kommissionsgeschäft. In dieser Zeit der
"Gründerjahre"
wurde die Kneiphöfische Langgasse modernisiert. Das enge Stadttor und die
Beischläge, die man im Bild von 1864
sieht,
wurden abgerissen, die Pregelbrücken wurden verbreitert, wie
man
im Bild von 1900 sieht, und alsbald wurden die Gleise für die
Pferdebahn verlegt. Paul Lemmel, der hier nun seine Weinhandlung
eröffnete, hatte im Königsberger Bankhaus "Simon Witwe und
Söhne"
(später Ostbank für Handel und Gewerbe) den
Kaufmannsberuf
erlernt und sich dann nach einer halbjährigen Ausbildung in
Bordeaux auf den Import von französischen Weinen
spezialisiert.
Zusätzlich errichtete er in Mittel-Tragheim 39 ein Weinlager.
Das
Geschäft gedieh, so dass das Haus in der
Kneiphöfischen
Langgasse schließlich zur Gänze als
Geschäftshaus
genutzt wurde. Ein Wohnhaus erwarb er in der
Königstraße
Nr.8, von wo er mit der Pferdebahn bis zum Kaiser-Wilhelm-Platz fuhr,
um in sein Geschäft zu kommen. Das gab er 1903 auf und lebte
schließlich als "Rentier" in der
Königstraße.

Paul Lemmel
und Elise geb.
Ostendorff 
Er hatte eine Tochter von Gottfried Ostendorff
geheiratet, dem
Direktor
der Union-Gießerei, die nicht nur Dampfmaschinen und
Lokomotiven
herstellte sondern 1896 auch die aufklappbaren Pregelbrücken
errichtete.
1 2
2
1. Lokomotive T13, 1912 von der Union-Gießerei gebaut [Kbger Bürgerbrief Nr.81, 2013]
2. Aufgeklappte Pregelbrücke, 1896 von der Union-Gießerei errichtet [Foto unbekannter Herkunft]
Paul Lemmel saß
40 Jahre im
Aufsichtsrat der Union-Gießerei. Er hatte mehrere
Ehrenämter. Als Vorsitzender der Ostpreußischen
Blindenunterrichtsanstalt eröffnete er die neu erbaute
Blindenanstalt in Königsberg auf den Hufen, wovon die
Königsberger Allgemeine Zeitung vom 18.10.1909 berichtete.

: : : :

Nach dem frühen Tod seines Vaters Carl, der als Kaufmann und Versicherungs-Agent in Bartenstein gelebt hatte, musste Paul Lemmel für seine Mutter und acht Geschwister sorgen, die nun alle im Hause Kneiphöfische Langgasse 41 wohnten. Pauls ältere Schwester, Laura Frost geborene Lemmel, war nach kurzer Ehe bereits verwitwet. Zur Verwunderung ihrer konservativen Mutter wurde sie Schriftstellerin und Frauenrechtlerin. In der Hartungschen Zeitung richtete sie eine Ecke "Für die Frau" ein - eine Aufsehen erregende Neuerung. 1901 brachte sie in der Hartungschen Druckerei ein Buch mit 97 Seiten heraus: "Der Dom zu Königsberg. - Ein Denkmal der geschichtlichen Entwicklung Altpreußens".

: : : :

Nach dem frühen Tod seines Vaters Carl, der als Kaufmann und Versicherungs-Agent in Bartenstein gelebt hatte, musste Paul Lemmel für seine Mutter und acht Geschwister sorgen, die nun alle im Hause Kneiphöfische Langgasse 41 wohnten. Pauls ältere Schwester, Laura Frost geborene Lemmel, war nach kurzer Ehe bereits verwitwet. Zur Verwunderung ihrer konservativen Mutter wurde sie Schriftstellerin und Frauenrechtlerin. In der Hartungschen Zeitung richtete sie eine Ecke "Für die Frau" ein - eine Aufsehen erregende Neuerung. 1901 brachte sie in der Hartungschen Druckerei ein Buch mit 97 Seiten heraus: "Der Dom zu Königsberg. - Ein Denkmal der geschichtlichen Entwicklung Altpreußens".

Laura Frost geb. Lemmel. - Zu ihrem Werkeverzeichnis
Der jüngste
Bruder, Ernst Lemmel,
war noch Schüler
auf dem Altstädtischen Gymnasium. Nicht weit von der
Lemmelschen
Weinhandlung, Kneiphöfische Langgasse 36, gab es das
Zigarren-Geschäft "Carl
Peter".
Wein und Zigarren, das passt.
Ernst Lemmel von der Weinhandlung verlobte sich mit Charlotte Peter vom
Zigarrengeschäft, und am 27.10.1898 war die Trauung im Dom.
Sie
wurden meine Großeltern.
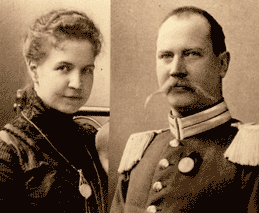
Charlotte Peter und Ernst Lemmel
Ernst Lemmel war Jurist und
wurde
Stadtrat in Posen, von wo er 1919 mit seiner Familie in seine
Heimatstadt zurückkehrte. In Erinnerung ist mir geblieben,
dass er
für den Tiergarten etwas gestiftet hatte, so dass wir dort
"lebenslang" freien Eintritt hatten.
Urgroßvater Carl Peter war in
Preußisch
Holland geboren und hatte in Heiligenwalde, ein paar Meilen
östlich von Königsberg, die Gutsbesitzers-Tochter aus
Pogauen
Mathilde Kadgiehn
geheiratet.
Er eröffnete 1860 in der Kneiphöfischen Langgasse 36
sein
Zigarren-Geschäft.



Carl Peter und seine Frau Mathilde geb. Kadgiehn, um 1865
Das Geschäft wurde
recht
erfolgreich. Carl Peter erwarb noch das Nachbarhaus
Kneiphöfische
Langgasse 35, zwei rückwärtige Häuser in der
Kneiphöfischen Hofgasse 12 und 13, sowie einen Komplex
nördlich des Schlosses, Junkerstr. 18/19. Zur Glanzzeit um
1900
und bis in die 1920er Jahre war hier im Kneiphof die Zentrale von 50
Filialen, die die Kunden in Königsberg, Danzig und vielen
ostpreußischen Kleinstädten mit Zigarren versorgten.
Im
Volksmund hieß es, "Carl Peter" sei ein Hundename, weil er an
jeder Ecke sein Geschäft mache. Das vornehmste
Geschäft lag
Ecke Kantstraße zu Füßen des Schlosses.
Carl Peter starb 1901. Da der ältere Sohn, Dr.med. Waldemar Peter, als Arzt tätig war, übernahm der jüngere Sohn, Carl Peter junior, der gerade sein Jurastudium abgeschlossen hatte, im Alter von erst 21 Jahren das Geschäft.
Carl Peter starb 1901. Da der ältere Sohn, Dr.med. Waldemar Peter, als Arzt tätig war, übernahm der jüngere Sohn, Carl Peter junior, der gerade sein Jurastudium abgeschlossen hatte, im Alter von erst 21 Jahren das Geschäft.

Carl Peter junior, 1898 als Abiturient mit "Alberten"
Er starb aber schon 1914,
so dass nun
Herr Julius Priebe
als
Geschäftsführer eingesetzt wurde. 1919 wurde "Carl
Peter –
Danzig", da Danzig nunmehr Ausland war, als separate Firma abgespalten.
Der Jahresumsatz betrug 1939 mehr als zwei Millionen Reichsmark. Die
Gesellschafter waren die Familien der Carl-Peter-Töchter: Tupschöwski,
Lemmel, Franck,
sowie Dr. Waldemar Peter und
die Witwe von Carl Peter junior, Edith
geb. Kullack, wiederverheiratete Gruber.
Ihr Schwager, Herr Rechtsanwalt Fünfstück,
war der juristische Beirat der Handelsgesellschaft. Er war ein Sohn des
Juditter Pfarrers Otto
Fünfstück, dessen Grabstein noch heute
bei der
Juditter Kirche zu sehen ist.

Grabstein in Juditten (Foto 1991)
Inschrift rechts: Otto Fünfstück, Pfarrer von Juditten 1893-1923, † 16.5.1928;
links: Marie Fünfstück geb. Werner † 9.5.1928.
Bereits um 1900 betrieb man
in der
Familie Genealogie, wobei man feststellte, dass einige Vorfahren-Linien
schon Jahrhunderte zuvor auf der Pregelinsel ansässig gewesen
waren. Paul Lemmels Mutter war Marie
Schumann aus einer Danziger Kaufmanns- und Rats-Familie
mit
einer weit zurück reichenden Ahnentafel.


Marie geb. Schumann, Carl Lemmel
Eine der vielen Ahnen war
die Danziger
Kaufmanns-Ehefrau Anna
Schillings,
die 1537 als 42-jährige Witwe nach Frauenburg zog, um hier den
alternden Copernicus
als
Wirtschafterin zu versorgen. Sie hatte aber 13 Kinder im Alter zwischen
2 und 22 Jahren, darunter einige ansehnliche Töchter, die in
der
Domburg Anlass zu Gerüchten gaben. Das nützte der
Fürstbischof Johann
Dantiscus
aus, um gegen Copernicus zu intrigieren. Nach längerem Streit
musste Copernicus Anfang 1539 nachgeben und seine Haushälterin
entlassen. Copernicus erwähnt in einem an Bischof Dantiscus
gerichteten Rechtfertigungsbrief, dass er "jene Person", nachdem er sie
entlassen habe, nicht wiedergesehen habe, außer einmal "auf
dem
Markt in Königsberg". Unsere Ahnfrau, die Witwe Anna
Schillings,
hatte sich also 1539 in Königsberg niedergelassen. Von
Frauenburg
kommend war sie mit Kindern und Hausrat auf Pferdewagen durch die
Kneiphöfische Langgasse gereist, um zur Altstadt
Königsberg
zu gelangen.
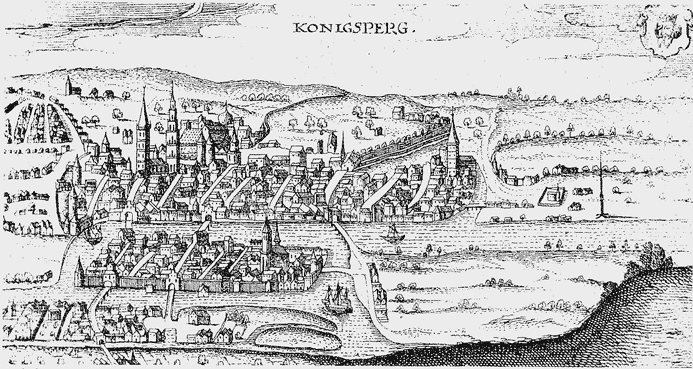 Königsberg
um 1630.
Königsberg
um 1630.
[Radierung von Johann Ludwig Gottfried in "Inventarium Sueciae. Abgedruckt in der Preußischen Allgemeinen Zeitung, 12.11.2005]
Im Kneiphof ist unser frühester bekannter Vorfahr der
Schönfärber Martin
Gablentz,
der 1661 als "Ratsfärber" des Kneiphofs angestellt wurde und
in
der Folge seine Kinder im Dom taufen ließ.
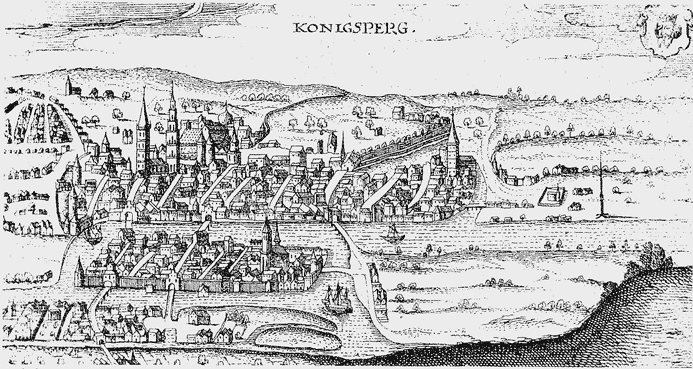 Königsberg
um 1630.
Königsberg
um 1630. [Radierung von Johann Ludwig Gottfried in "Inventarium Sueciae. Abgedruckt in der Preußischen Allgemeinen Zeitung, 12.11.2005]

Der Dom. [Bild: Museum Stadt Königsberg]
Er betrieb seine
Färberei, die viel
Wasser benötigte, am linken Pregelufer flussabwärts
auf der
Kneiphöfischen "Klapperwiese". Sein Sohn Johann Georg Gablentz war
kurfürstlicher Schönfärber am Schlossteich.
Der andere
Sohn, Martin,
erbte die
Kneiphöfsche Färberei, bei der er
auch als "Seidenfärber" bezeichnet wird. Die Färber
waren in
einem "Gewerk" zusammengeschlossen, das zum Beispiel den Einkauf von
Indigo und anderen Färberwaren regelte. Vermutlich war die
Familie
Gablentz schon längere Zeit in Königsberg
ansässig, aber
ältere Urkunden darüber waren nicht erhalten.
Der Bedeutung der Handelsstadt entsprechend zogen ständig Kaufleute von auswärts zu. Um das Bürgerrecht im Kneiphof zu erwerben und ein Handelshaus zu eröffnen, war es günstig, eine einheimische Kaufmannstochter zu heiraten. Und so heiratete 1684 im Dom der Neubürger und Seidenhändler Georg Düring die Schwester des Seidenfärbers Martin Gablentz, mit der er im Kneiphof nahe der Schmiedebrücke wohnte. Deren Tochter heiratete im Dom 1706 den aus dem westpreußischen Strasburg gekommenen kneiphöfischen Handelsherrn Martin Horn, und nach dessen Tod in zweiter Ehe 1725 den aus Elbing gekommenen Christoph Thiergart, einen tüchtigen "Kauf- und Handelsmann auf dem Kneiphoff". Er erwarb zwei Wohnhäuser, Kneiphöfische Langgasse Nr.48 und 49 (letzteres war das Eckhaus Brodbänkengasse), sowie Grundstücke an der Krämerbrücke und einen Speicher am Pregelufer auf der Lastadie. Schließlich bezog er sein Haus auf der Altstädter Seite der Krämerbrücke (Kantstraße), doch fand seine Beisetzung 1783 wiederum im Dom statt.
Sein Schwiegersohn war der "Negotiant" Friedrich Pfeiler aus Elbing, der nach seiner Heirat 1757 in Königsberg weiterhin in Elbing lebte, bis er 1784 das Geschäft seines verstorbenen Schwiegervaters übernahm und in dessen Haus an der Krämerbrücke einzog. Er handelte mit "Gold, Silber, Seidenwaren und Kameelgarn" und soll zuvor in Elbing 100.000 Rubel im Russland-Handel verloren haben. Dessen Schwiegersohn wurde Jakob Symanski aus Masuren, geboren 1754 in Mierunsken Kreis Lyck. Er war zunächst in der Lehre bei dem Kaufmann Christian Gotthold Turowski, erwarb dann in der Altstadt das Bürgerrecht "auf den Gran- und polnischen Handel" und zog nach seiner Heirat 1786 im Dom in den Kneiphof, wo er schließlich die Thiergartschen Häuser in der Kneiphöfischen Langgasse und einen Speicher auf der Lastadie besaß, aber schon im Jahr 1800 starb. Die Witwe heiratete den Oberstleutnant Christoph Friedrich von Quednow und starb hoch betagt auf dessen Gut in Schaaken.
Der Sohn Carl Wilhelm Symanski, der beim Tod des Vaters erst neun Jahre alt war, konnte, vom Stiefvater gefördert, die Universität in ihrem alten Gebäude hinter dem Dom besuchen und wurde Jurist.
Der Bedeutung der Handelsstadt entsprechend zogen ständig Kaufleute von auswärts zu. Um das Bürgerrecht im Kneiphof zu erwerben und ein Handelshaus zu eröffnen, war es günstig, eine einheimische Kaufmannstochter zu heiraten. Und so heiratete 1684 im Dom der Neubürger und Seidenhändler Georg Düring die Schwester des Seidenfärbers Martin Gablentz, mit der er im Kneiphof nahe der Schmiedebrücke wohnte. Deren Tochter heiratete im Dom 1706 den aus dem westpreußischen Strasburg gekommenen kneiphöfischen Handelsherrn Martin Horn, und nach dessen Tod in zweiter Ehe 1725 den aus Elbing gekommenen Christoph Thiergart, einen tüchtigen "Kauf- und Handelsmann auf dem Kneiphoff". Er erwarb zwei Wohnhäuser, Kneiphöfische Langgasse Nr.48 und 49 (letzteres war das Eckhaus Brodbänkengasse), sowie Grundstücke an der Krämerbrücke und einen Speicher am Pregelufer auf der Lastadie. Schließlich bezog er sein Haus auf der Altstädter Seite der Krämerbrücke (Kantstraße), doch fand seine Beisetzung 1783 wiederum im Dom statt.
Sein Schwiegersohn war der "Negotiant" Friedrich Pfeiler aus Elbing, der nach seiner Heirat 1757 in Königsberg weiterhin in Elbing lebte, bis er 1784 das Geschäft seines verstorbenen Schwiegervaters übernahm und in dessen Haus an der Krämerbrücke einzog. Er handelte mit "Gold, Silber, Seidenwaren und Kameelgarn" und soll zuvor in Elbing 100.000 Rubel im Russland-Handel verloren haben. Dessen Schwiegersohn wurde Jakob Symanski aus Masuren, geboren 1754 in Mierunsken Kreis Lyck. Er war zunächst in der Lehre bei dem Kaufmann Christian Gotthold Turowski, erwarb dann in der Altstadt das Bürgerrecht "auf den Gran- und polnischen Handel" und zog nach seiner Heirat 1786 im Dom in den Kneiphof, wo er schließlich die Thiergartschen Häuser in der Kneiphöfischen Langgasse und einen Speicher auf der Lastadie besaß, aber schon im Jahr 1800 starb. Die Witwe heiratete den Oberstleutnant Christoph Friedrich von Quednow und starb hoch betagt auf dessen Gut in Schaaken.
Der Sohn Carl Wilhelm Symanski, der beim Tod des Vaters erst neun Jahre alt war, konnte, vom Stiefvater gefördert, die Universität in ihrem alten Gebäude hinter dem Dom besuchen und wurde Jurist.
 ©HDLemmel
©HDLemmel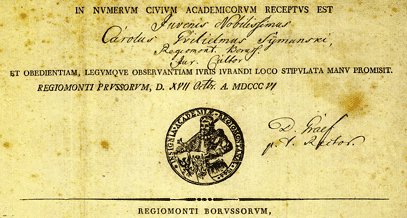 ©HDLemmel
©HDLemmel Carl Wilhelm Symanski: Lithografie der Albertina (vor 1836) aus seinem
Besitz. - Seine Immatrikulations-Urkunde von 1806 (Ausschnitt).
1826 heiratete er die
Tochter Friederike
des Professors Theodor
Rinck.
Der hatte um 1790 bei Kant
studiert, wurde Mitglied seiner Tafelrunde und gab nach Kants Tod
einige seiner Schriften heraus. Sein mütterlicher
Großvater Joachim
Rau und dessen
Schwiegervater Christian
Schiffert
waren Lehrer des jungen Kant gewesen, als dieser von 1732 bis 1740 das
Collegium Fridericianum besuchte.
1.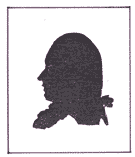 2.
2.
1. Dr.phil. et theol.Theodor Rinck, 1794-1801 Professor der Albertina
Scherenschnitt aus dem Besitz seines Enkels Johannes Symanski
2. Seine Tochter Friederike um 1850 als Witwe Friederike Symanski geb.Rinck
Am 3. Dezember 1840 fand im
Dom die
Trauerfeier für den im Alter von erst 49 Jahren verstorbenen
Geheimen Justizrat Carl Wilhelm Symanski statt, der im
Erbbegräbnis des Dom-Kirchhofes beerdigt wurde. - Carl Wilhelm Symanski hatte
ein
künstlerisches Talent, das er auch an seine Nachkommen
vererbte.
Hier eine Porträt-Zeichnung seiner drei Söhne.

Der Sohn Johannes
Symanski, im
Bild der mittlere, studierte Jura an der Königsberger
Universität Albertina, die sich damals noch auf der
Kneiphof-Insel neben dem Dom befand.
 Die alte Albertina am Dom [Wikipedia]
Die alte Albertina am Dom [Wikipedia]
Er wurde schließlich Landesgerichtsrat in Königsberg. Nach seiner Pensionierung war er ein leidenschaftlicher Aquarell-Maler.

 Die alte Albertina am Dom [Wikipedia]
Die alte Albertina am Dom [Wikipedia]Er wurde schließlich Landesgerichtsrat in Königsberg. Nach seiner Pensionierung war er ein leidenschaftlicher Aquarell-Maler.


Johannes Symanski, Aquarell: Steilküste bei Rauschen, 1907
Seine Tochter Helene
besuchte die
"Höhere Töchterschule" in Königsberg. Ihre
Schulfreundin war Agnes
Miegel,
der wir 1939 mit einem Blumenstrauß zum 60. Geburtstag
gratulierten. Helene heiratete den Juristen und Stadtrat Martin Sembritzki,
und dazu muss ich
wieder etwas ausholen.
Zwischen 1765 und 1799 kamen gleich sechs Kaufleute namens Sembritzki aus Masuren in den Kneiphof, als "Händler mit polnischen Waaren" oder auch als "Gewürzapotheker". Unter ihnen war unser Vorfahr Gottfried Sembritzki, 1766 als Lehrerssohn in Treuburg/Oletzko geboren. Er hatte in Memel die englische Kaufmannstochter Elisabeth Anderson geheiratet und erwarb 1799 das Bürgerrecht im Kneiphof als "Kaufmann auf den Handel mit seidenen, baumwollenen, wollenen und sonstigen Manufactur-Waaren". Für den Einkauf von Wollwaren fuhr er vom Kneiphof aus zur See bis nach Schottland, wo 1803 sein Sohn Ferdinand geboren wurde. Dieser wurde Schuhmachermeister in der Kneiphöfischen Langgasse Nr.33, dicht an der Krämerbrücke, wo er 1843 als "Schuhfabrikant" lebte, aber bereits 1854 starb. Seine Witwe, Charlotte geborene Zimmermann, stammte vom Gut Contienen südwestlich von Königsberg.
Zwischen 1765 und 1799 kamen gleich sechs Kaufleute namens Sembritzki aus Masuren in den Kneiphof, als "Händler mit polnischen Waaren" oder auch als "Gewürzapotheker". Unter ihnen war unser Vorfahr Gottfried Sembritzki, 1766 als Lehrerssohn in Treuburg/Oletzko geboren. Er hatte in Memel die englische Kaufmannstochter Elisabeth Anderson geheiratet und erwarb 1799 das Bürgerrecht im Kneiphof als "Kaufmann auf den Handel mit seidenen, baumwollenen, wollenen und sonstigen Manufactur-Waaren". Für den Einkauf von Wollwaren fuhr er vom Kneiphof aus zur See bis nach Schottland, wo 1803 sein Sohn Ferdinand geboren wurde. Dieser wurde Schuhmachermeister in der Kneiphöfischen Langgasse Nr.33, dicht an der Krämerbrücke, wo er 1843 als "Schuhfabrikant" lebte, aber bereits 1854 starb. Seine Witwe, Charlotte geborene Zimmermann, stammte vom Gut Contienen südwestlich von Königsberg.

Charlotte Sembritzki geb. Zimmermann
Der Sohn Rudolf Sembritzki,
der in Pillau die
Bäckermeisters-Tochter Louise
Krieger heiratete, war Schiffsbau-Ingenieur. Sein
Schwiegervater
Friedrich Krieger,
der aus
Nordenburg stammte und von 1812 bis 1815 im Kneiphof das
Bäckerhandwerk erlernt hatte, versorgte in Pillau die
hinausfahrenden Schiffe mit Schiffszwieback. Rudolf Sembritzki wohnte
nicht
mehr auf der Kneiphof-Insel sondern in der südlich
angrenzenden
Vorstadt, Hintere Vorstadt 8. Hier lebte auch sein Bruder Henry Max Sembritzkials
Papiermacher und Pappenfabrikant, nachdem er zuvor als Kaufmann in
Schirwindt an der russischen Grenze Konkurs gemacht hatte. Rudolfs Sohn
Martin besuchte das Kneiphof-Gymnasium, studierte Jura an der
Königsberger Universität heiratete 1900 im Dom die schon
erwähnte Helene Symanski.

Helene Symanski, Martin Sembritzki
Nun aber lebte man nicht
mehr im
Kneiphof sondern im neuen westlichen Vorort Amalienau, wo der Stadtrat Martin Sembritzki
1901 für
seine Familie ein Haus baute, Hammerweg 2. Gleich um die Ecke,
Hardenbergstraße Nr.4, zog 1920 der Stadtrat Ernst Lemmel ein,
und beider Kinder
heirateten 1932 und wurden meine Eltern. Eines Tages fuhren sie mit der
Straßenbahn durch die Kneiphöfische Langgasse zum
Hauptbahnhof, nicht ahnend, dass es das letzte Mal war.
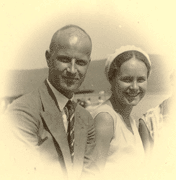
Gerhard Lemmel, Vera geb. Sembritzki
Die Sage berichtet, dass die verschwundene Stadt Vineta alle hundert Jahre am Ostermorgen aus dem Meer auftauchen soll, und dass man dann ihre Glocken läuten hören kann. Der Kneiphof aber ist in alle Ewigkeit verschwunden. Doch wenn du, lieber Leser, von der Kaliningrader Brücke hinunterblickst und dem Läuten der Domglocken lauschst, kannst du vielleicht unter der Brücke den Kneiphof und das geschäftige Treiben seiner Bewohner in vergangenen Jahrhunderten vor deinem inneren Auge wieder auferstehen lassen.
<<<< >>>>
Die erwähnten Handelshäuser in der Kneiphöfischen Langgasse:


Die Krämerbrücke. Links das erste Haus der Kneiphöfischen Langgasse, in dem Ferdinand Sembritzki um 1950 seine Schuhfabrik hatte.
<<<< >>>>
Weitere Königsberg betreffende Aufsätze von Hans-Dietrich Lemmel:
Zu seinem 200. Todestag 2004: Genealogische Notizen zu Immanuel Kant gedruckt 2004, seither unwesentlich ergänzt
Zu seinem 225. Geburtstag 2001: E.T.A. Hoffmanns Vorfahren gedruckt 2001, seither unwesentlich ergänzt
Zigarren-Import Carl Peter in Königsberg
Die Union-Gießerei in Königsberg
Erinnerungen von Helene Sembritzki geb. Symanski
Johannes Symanski, Landgerichtsrat in Königsberg (1832-1917)